| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: PDS / Linkspartei | 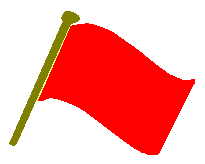 |
Wahlen im Nordosten:
Wie reagiert die Linke?
SPD und Linkspartei weiter auf neoliberalem Kurs
In Berlin verlor die Linkspartei/PDS bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 181.206 Stimmen von zuvor 366.292 Stimmen. Fast jede zweite Stimme. Auch die SPD verlor gut 58.000 Stimmen, konnte aber dank der niedrigen Wahlbeteiligung von nur noch 58 % ihren prozentualen Stimmenanteil etwas steigern. Im Gegensatz zur Linkspartei/PDS. Deren Anteil an den abgegebenen Stimmen ging um 9,2 % zurück.
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Linkspartei/PDS bei diesen Landtagswahlen trotz Stimmenverlusten wegen des Rückgangs der Wahlbeteiligung ihren Stimmenanteil halten können. Seitdem sie dort das erste Mal in eine Koalitionsregierung eintrat, gingen ihr rund Zweidrittel der Anhänger von der Fahne. Bei dieser Wahl 28.000 Wähler. Die SPD verlor rund 150.000 Stimmen, ihr Stimmanteil sank um 10,4 %.
Weder die SPD, noch die Linkspartei/PDS sehen in Stimmenverlusten und in der seit Jahren zurückgehenden Wahlbeteiligung ein Problem. Es beunruhigt sie nicht, daß sich immer mehr ihrer Wähler von ihnen abwenden, weil sie ihre Interessen mit Füßen getreten sehen. Die Parteiführer dieser Parteien werden allenfalls unruhig, wenn der Stimmanteil ihrer Parteien zurückgeht. Die Linkspartei/PDS in Berlin hatte sogar ganz offen einkalkuliert, daß sie rund 5%-Punkte verlieren würde. Sie war dennoch entschlossen, ihren antisozialen Kurs beizubehalten, von dem sie vorgibt, daß er alternativlos ist. Der Verlust von 9,2 % war aber mehr als erwartet und führte in den eigenen Reihen zu einem Hauch von Aufregung. Es gab weniger Posten zu verteilen als vorgesehen; es wird Finanzpprobleme für den Parteiapparat geben und die bequemen Regierungssessel wackelten, in denen man sich eingerichtet hatte.
Aber nach kurzer Irritation haben die prokapitalistischen Apparate von SPD und Linkspartei/PDS begonnen, da weiter zu machen, wo sie aufgehört haben. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat wegen der Zweifel in die Solidität einer rot-roten Mehrheit beschlossen, nach dem Muster der Großen Koalition mit der CDU/CSU im Bund ihre alte antisoziale Politik mit den Christdemokraten fortzusetzen. Die Linkspartei/PDS beschloß in Berlin, mit über 85 % der Delegiertenstimmen, so weiter zu machen wie bisher. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg bekräftigte die PDS, daß sie ihr Heil darin sieht, gemeinsam mit der SPD Politik zu betreiben. Der Parteiapprat zeigte damit, daß er seine Partei fest im Griff hat. Er hält seinen neoliberalen Kurs.
Die WASG zwischen Anpassung und Widerstand
Die WASG, erst 2004 entstanden, um jeder Form neoliberaler Politik den Kampf anzusagen und für eine soziale Politik zu kämpfen, mochte sich 2005 angesichts der vorgezogenen Neuwahlen zum Bundestag nicht aus dem für sie allein noch aussichtslosen Kampf um Parlamentsmandate heraushalten. Sie optierte deshalb für das Bündnis mit der PDS und gegen eine erzwungene Beschränkung auf außerparlamentarischen Widerstand gegen die neoliberale Politik der herrschenden Klasse und ihrer Regierung.
Mit Lafontaine und Klaus Ernst an der Spitze übt sie sich seitdem im Bundestag in scheinradikaler Rhetorik und unterstützt zugleich in den Ländern den in der Linkspartei alles beherrschenden PDS-Apparat. Dieser aber will sich auf radikale Rhetorik nicht mehr einlassen. Seine Sprachrohre sind entschlossen, sich ohne wenn und aber ins kapitalistische Räderwerk einzugliedern. Wie die SPD-Bürokraten glauben sie, daß sie den Kapitalismus besser verwalten können als die Kapitalisten. Die WASG-Spitze beugte sich den Forderungen des PDS-Apparats ohne jeden Widerstand. In Berlin hieß das, den Wahlantritt des WASG-Landesverbandes zu verhindern. Folgerichtig wurde der eigene Landesverband von der Parteiführung mit allen Mitteln bekämpft: Mit bürokratischen Tricks und Manövern, öffentlichen Stellungnahmen gegen die eigene Partei, Verleumdungen des linken Parteiflügels und bis zuletzt mit Wahlaufrufen für die PDS. Dazu wurde eine Minderheit des WASG-Landesverbandes (maßgeblich um Linksruckmitglieder) unterstützt, den Wahlkampf der eigenen Partei zu sabotieren.
Ohne finanzielle Hilfe durch die Bundespartei und gestützt auf gut 200 Basisaktivisten legte die WASG dennoch einen fulminanten Straßenwahlkampf hin, Sie trat deutlich sichtbar als DIE Opposition gegen den von der rot-roten Senatskoalition betriebenen Sozialabbau in Erscheinung, war da, wo es Widerstand gegen die neoliberale Politik des Senats gab, beim Streik des Charité-Personals, bei den streikenden Arbeitern des Siemens Hausgerätewerkes in Spandau, bei streikenden Schülern. Sie gewann ihre Stimmen vor allem bei Arbeitslosen, ehemaligen Nichtwählern und Jugendlichen. Bei den Erststimmen erzielte sie 52.000 Stimmen (3,8%), bei den Zweitstimmen 40.000 (2,9 %). Obwohl sie im Osten weniger Mitglieder hat, als im Westen, schnitt sie im Osten etwas besser ab. Sie überwand in sieben Stadtbezirken die 3%-Hürde und zieht dort in die Bezirksversammlungen ein.
Dieses trotz allem beachtliche Ergebnis blieb hinter den Erwartungen der WASG-Aktivisten deutlich zurück. Die WASG war letztlich nicht in der Lage, eine kritische Masse ehemaliger Nichtwähler davon zu überzeugen, daß ihr der Einzug ins Abgeordnetenhaus gelingen könnte. Es gelang ihr auch nicht, das Vertrauen der abgesprungenen Linkspartei/PDS-Wähler zu erringen (von diesen wählte nicht einmal jeder Zehnte die WASG). Hier rächte sich, daß es die Berliner WASG versäumte, sich klar, laut und unmißverständlich von Oskar Lafontaine und seiner Fusionspolitik zu distanzieren. Die Berliner WASG, wie die WASG-Linke bundesweit, konnte sich vor der Wahl nicht einmal zu der Aussage durchringen, daß eine Fusion mit der Linkspartei/PDS für sie nur für den Fall in Frage käme, daß diese ihren neoliberalen Kurs aufgäbe.
Im Wahlkampf war häufig zu hören, weshalb man denn WASG wählen solle, wo diese doch sowieso im nächsten Jahr mit der Linkspartei zusammengehen würde. Lafontaines verlogene Unterstützung der Berliner Politik der Linkspartei/PDS und ihrer neoliberalen Apparatschiks nützte diesen nichts, schadete aber der WASG. Viele Wähler, die von der kapitalistischen Regierungspolitik der PDS enttäuscht waren und nicht mehr wählen gingen, bemängelten, daß sich die WASG nicht klar und bestimmt zu einer sozialistischen Politik bekannte. Sie sahen die WASG deshalb nur als rechte Alternative zur Linkspartei. Die politische Selbstbeschränkung der WASG auf den Kampf gegen antisoziale Politik machte sie als linke Partei für viele linke Kritiker der PDS unglaubwürdig.
Die "Spaltung der Linken", die Linksruck als Ursache dafür vermutet, daß immer mehr Wähler zu Hause blieben, war nichts als eine Kampfparole derjenigen, die ungestört von linker Opposition weiter neoliberale Politik betreiben wollten. Reale linke Politik wurde von der Linkspartei/PDS nicht betrieben. Der Versuch, ihre neoliberale Politik als links zu etikettieren, entspringt einem Hirngespinst der Linksruck-Ideologen. Der Wahlantritt der WASG in Berlin war demgegenüber ein richtiger Ansatz, der modernen neoliberalen Variante kapitalistischer Politik den Kampf anzusagen und mit realer linker Politik zu beginnen. Nur die Manöver von Linksruck und Lafontaine waren spalterisch und haben linke Politik behindert.
Daß der Wahlantritt der WASG die Linke einschließlich der Linkspartei/PDS nicht zur gesellschaftlichen Schwächung der Linken führt, zeigt das Beispiel der Wahl zur Bezirksversammlung Tempelhof-Schönberg, wo die Linkspartei/PDS und die WASG 2006 zusammen mehr Stimmen erzielten, als 2001 die PDS allein (9.500:7.000).
Bürgerlicher Protest und die NPD
Die katastrophalen Auswirkungen der modernen kapitalistischen Politik auf die soziale Situation von Jugendlichen, Lohnabhängigen, Arbeitslosen und Rentnern haben immer noch nicht dazu geführt, daß die Linke als politische Kraft widerauferstanden ist. Die Desorientierung und Demoralisierung nach dem Zusammenbruch der Arbeiterstaaten, die auch die nichtstalinistische Linke betraf, dauern trotz erster ermutigender Zeichen an. Die Schwäche der Linken hat die Spitzen der prokapitalistischen Parteien in den letzten Jahren dazu ermutigt, den Sozialabbau immer mehr zu beschleunigen. Die Angriffe auf die sozialstaatlichen Errungenschaften früherer Jahre, dreist als "Reformen" bezeichnet, werden immer unverschämter vorgetragen.
Dies hat dazu geführt, daß bereits in den letzten Jahren ein vagabundierendes Wählerpotential entstand. Immer größere Teile der von den Konterreformen Betroffenen wenden sich von der politischen Klasse ab, enthalten sich bei Wahlen oder wenden sich irgendwelchen Protestparteien zu. Die Unruhe und Unzufriedenheit ergreift nicht nur Arbeitslose und Geringverdiener, sondern auch lange Zeit saturierte Wählerschichten. Selbst die Volkspartei CDU ist betroffen. Es entstand sowohl linkes wie ein teils wertkonservatives, teils rechtskonservatives und ein Wählerpotential für offen auftretende Faschisten..
Nur das letztere, das Protest und Widerstand will, ist auch für antikapitalistische Linke erreichbar. Der "altbürgerliche" Protest tendiert zu Formationen wie der Schillpartei oder, jetzt in Berlin, zu den Grauen. Letztere haben dementsprechend in den wohlhabenden Berliner Stadtbezirken Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Charlottendorf-Wilmersdorf Erfolge verzeichnet. Die Faschisten hatten ihre Erfolge dort, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist. Sie werden nicht gewählt, weil von ihnen Lösungen für die Probleme der Arbeitslosen erwartet werden, sondern nur unüberhörbarer Protest gegen die soziale Misere. Wo den Faschisten keine aktive Linke entgegentrat, wie in Mecklenburg-Vorpommern, erstarkten sie.
Die Beteiligung von dem Anspruch nach linken Parteien an bürgerlichen Regierungen, ihre Unterordnung unter neoliberale Dogmen, diskreditiert die Linke nicht nur, sie treibt die Opfer dieser Politik in die Arme der Faschisten. Der braune Bodensatz kann mit seiner Propaganda nur erfolgreich sein, wo die soziale Misere ausweglos erscheint. SPD und Linkspartei/PDS tragen daher mit ihrer Politik der kapitalistischen Krisenverwaltung für die Erfolge der NPD in Mecklenburg-Vorpommern (60.000 Stimmen, 7,3 %) und Berlin (2,6 %, im Osten 4 %) politische Mitverantwortung.
Selbst der offizielle Antifaschismus versagt. Pflichtschuldigst empört sich die Gemeinschaft der "Demokraten" und pflegt parlamentarische Ausgrenzungs- und Boykottrituale, wenn Faschisten 5%-Hürde überschreiten. Darunter wird das Problem von der bürgerlichen politischen Klasse ausgesessen. Die zunehmende soziale Verankerung der Faschisten in Elendsregionen wird ignoriert. Nicht einmal Gelder für Sozialarbeiter werden bereitgestellt. Man läßt die Faschisten im Armutsghetto gewähren, weil man darauf setzt, daß sie an ihren inneren Widersprüchen scheitern. Dies droht für die Arbeiterklasse und die Linke angesichts des Kampfs der Faschisten um "national befreite Zonen" eine immer größere Hypothek zu werden. Die etablierte Linke hat sich diesem Problem bisher überhaupt nicht gestellt.
Was nun?
Die hartleibige Unbelehrbarkeit des Linkspartei/PDS-Apparats findet ihre Ursache nicht darin, daß Leute wie der PDS-Wirtschaftssenator Wolf nicht wüßten, weshalb sie Wählerstimmen verloren haben. Es ist auch nicht möglich, mit diesen Leuten darüber zu diskutieren, wie linke Politik effektiv betrieben werden kann. Diese Leute wollen keine linke Politik. Sie wollen kapitalistische Politik mit den Kapitalisten machen. Und da sie die Erfahrung gemacht haben, daß in dieser Stagnationsperiode des Kapitalismus kapitalistische Politik mit sozialem Anstrich nicht ohne Konflikte mit dem Kapital möglich ist, sehen sie zum Neoliberalismus keine Alternative. Sie verwandelten sich daher von Neokeynesianern in Neoliberale.
Diese Erfahrung steht den zur Fusion mit der Linkspartei/PDS entschlossenen Teilen der WASG noch bevor. Die Naiven unter ihnen (u.a. Linksruck) werden lernen, daß der PDS-Apparat die Landesverbände der neuen Länder und damit schon aus quantitativen Gründen auch die fusionierte Linkspartei im sicheren Griff haben wird.
An die Offenheit und Veränderbarkeit einer Partei zu glauben und daran, es könne mit einer Partei einen neuen Aufbruch der Linken geben, die nach vernichtenden Niederlagen mit satten 85%-Mehrheiten beschließt, ihren verheerenden Kurs beizubehalten, ist nur noch psychologisch zu erklären. Die Aussicht auf Parlamentsmandate führt bei nicht wenigen zur Ausschaltung des Verstands.
Tausende von Mitgliedern haben angesichts des opportunistischen Rechtskurses der Führung um Lafontaine und der bevorstehenden Parteiliquidation bereits die WASG verlassen. Eine Minderheit der WASG widersetzt sich dem bevorstehenden Beitritt zur Linkspartei/PDS. Es ist absehbar, daß die Mehrheit des Berliner Landesverbandes die Verschmelzung der WASG mit der Linkspartei/PDS nicht mitvollziehen wird. Auf Bundesebene widersetzt sich das Netzwerk Linke Opposition der von der Parteirechten gesteuerten Fusion. Es fordert als Voraussetzung für eine Fusion einen klaren politischen Kurswechsel der Linkspartei/PDS, anderenfalls den Erhalt der WASG.
Die notwendige Selbstverständigung der WASG-Linken über ihren künftigen Kurs ist damit nur aufgeschoben. Ein "Zurück zu den WASG-Anfängen" kann es nicht geben. Die Fusion der WASG-Mehrheit um Klaus Ernst und Lafontaine mit der Linkspartei/PDS wird die politische Landschaft links von der dann neuen und wenigstens in den alten Ländern gestärkten Linkspartei erheblich verändern. Die Konzeption einer breiten Sammelpartei wird bereits dadurch ad absurdum geführt.
Die Hochburg der WASG-Linken, der Berliner Landesverband, diskutiert inzwischen die Perspektive einer "Regionalpartei". Das führt in jeder Hinsicht in eine politische Sackgasse. Eine Partei ist in erster Linie nicht dadurch gekennzeichnet, ob sie die dritte vierte oder sechste Partei im Parlament ist, sondern dadurch, welche sozialen Interessen sie repräsentiert, welche Ziele sie verfolgt und welche Stellung sie in der Gesellschaft und zu anderen Parteien einnimmt. Die Prognose, wo eine Partei erste Erfolge bei Parlamentswahlen erzielen kann, hat nichts mit der Frage zu tun, welche politische Perspektive von ihr verfolgt wird.
Gesellschaftsveränderung ist mit Regionalpolitik nicht möglich. Die Beschränkung auf regionale Politik bedeutet daher letzlich, sich mit der Verwaltung der Rationen zufriedenzugeben, die die "große Politik" den Regionen zuteilt. Die Größe der Rationen diktiert dabei die "Sachzwänge". Allenfalls können Regionen dann als Bittsteller antreten. Wer wissen will, wo das endet, sehe sich die Bemühungen des Berliner Senats um einen besseren Länderfinanzausgleich an.
Benötigt wird eine Partei, die die neoliberale Politik des Kapitals und seiner Parteien energisch bekämpft. Das bedeutet, sich von den illusorischen Konzepten des Neokeynesianismus zu lösen, den Schwerpunkt der Arbeit auf den außerparlamentarischen Protest und Widerstand gegen die Politik der Konterreformen zu legen, um gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern. In einer Phase der kapitalistischen Stagnation sind nur auf diesem Wege nennenswerte Erfolge möglich. Nur so läßt sich der Kampf um Tagesfragen mit dem Kampf um den Sozialismus verbinden. Eine solche Partei wird sich Bündnissen nicht verschließen. Aber der Schwerpunkt der Bündnisse wird im außerparlamentarischen Bereich liegen, nicht in Koalitionen, weil es aller Wahrscheinlichkeit nach weder für eine soziale noch für eine sozialistisch-gesellschaftsveränderne Politik eine ausreichende Zahl parlamentarischer Bündnispartner geben wird.
Am systematischen Aufbau einer solchen Partei führt kein Weg vorbei, unabhängig davon, wie weit dieses politische Projekt bereits realisiert werden kann. Hier erwächst der Berliner Linken eine besondere Verantwortung für einen linken Neubeginn.
Dieter Elken (Strausberg), 13.10.06