| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: PDS | 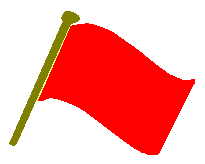 |
Die PDS hat nicht nur an Substanz, sondern auch an äußerem Glanz verloren. Parolen wie: “Den Kopf hoch, und nicht die Hände!” sind lange passé. Basisarbeit wird auf weiten Strecken kaum noch betrieben. Aber auch die Parlamentstätigkeit verkam zur Routine. Eine Ausnahme war der Schritt des stellvertretenden Fraktionschefs Wolfgang Gehrcke Anfang März, eine den Obleuten der Bundestagsfraktionen unter dem Siegel der Verschwiegenheit bekannt gegebene Nachricht zu veröffentlichen, wonach sich BRD-Streitkräfte wider die Abrede an Zugriffsaktionen gegen Taleban- und Al Quaida-Kämpfer in Afghanistan beteiligen. Partei- und Fraktionsführung billigten den Vorstoß, nutzten ihn aber nicht zur politischen Aufklärung der Massen.
Auseinandersetzungen im Vorfeld des Rostocker Parteitags
Wie weit die Anpassung an Politik und Gepflogenheiten der etablierten Parteien schon gediehen ist, zeigten Vorgänge in der Provinz und in Berlin. Die mecklenburg-vorpommersche PDS, zuvor aus Umweltschutzgründen gegen die Autobahn ab Lübeck entlang der Ostseeküste, drängt nun darauf, dass eine weitere Autobahn, die von Magdeburg nach Schwerin und später nach Wismar, auch noch fertiggestellt wird. In Neubrandenburg veranlasste die Delegiertenmehrheit beim Wahlparteitag den linken Abgeordneten Monty Schädel, Teilnehmer an Straßendemos, Jugendbündnissen, Flüchtlings-, Friedens- und Demokratisierungsinitiativen, zum Verzicht auf eine weitere Landtagskandidatur. In Sachsen-Anhalt forderte PDS-Vorsitzende Rosemarie Hein, nach der Wahl unbedingt in die Landesregierung einzutreten. Sie begründete das mit kleineren Verbesserungen in der Tolerierungszeit, umging aber das Ja der Partei zum Personalabbau in Kindertagesstätten und zur Aufstockung des Verfassungschutzes. Heidi Knake-Werner, Senatorin für Gesundheit und Soziales in Berlin und einst zur Bremer DKP gehörig, bekannte, bei Demonstrationen gegen Sozialabbau jetzt auf der anderen Seite zu stehen. Ihr Wunsch angesichts des forcierten Abbaus: “Vielleicht können nur wir das durchsetzen. Vielleicht traut man uns zu, dass wir so sozial wie möglich sparen.”
Unterdes trieb Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) Budgetkürzungen ohne Rücksicht aufs Soziale voran. PDS-Bezirksbürgermeister sahen sich zu teilweise harter Kritik gezwungen, weil für die Stadtbezirke keine Mittel mehr übrig bleiben würden. Bei einer Klausur der Abgeordnetenhausfraktion mit Sarrazin in Groß Dölln schlug Wirtschaftssenator Gregor Gysi vor, besonders harte Kürzungen aufs nächste Jahr zu verschieben, da der Bruch von Wahlversprechungen “uns unglaubwürdig macht”. Hingegen legte sich Fraktionsvorsitzender Harald Wolf für straffes Durchziehen der Abbau-Linie ins Zeug und schmähte Kritiker daran als Jammerlappen. Das “Tal der Tränen”, weissagte Wolf, werde länger dauern. Die PDS müsse ihre Nerven behalten, auch wenn sie in Umfragetiefs gerate.
Öffentliche PDS-Proteste wurden selbst dann nicht laut, als Sarrazin am 14. 3. erklärte, es müssten ausnahmslos alle “heiligen Kühe” geschlachtet werden, und weil auch das nicht ausreiche, sollten die öffentlich Bediensteten auf 10 Prozent ihres Gehalts verzichten. Zudem müssten Sozialhilfeempfänger nicht die gleichen Leistungen wie anderswo erhalten. Tage später strich der Senat den geplanten Doppelhaushalt für 2002/03 zusammen. Gysi und die Seinen blieben, um dabei zu sein, dem Parteitag in Rostock fern, obwohl die Streicherrunde hätte aufgeschoben werden können. Deren Resultate nannte Sarrazin eine bloße “Andeutung von Sparen”. Am 28. 3. ließen sich die Koalierten beim Verkauf eines Filetstücks am Zoobogen von der Bayerischen Immobilien AG über den Tisch ziehen. Ungeachtet des leeren Stadtsäckels stießen sie das Objekt 31 Mill. € unter seinem Verkehrswert ab.
Vertreter der Parteilinken kritisierten den Kurs der PDS. Sahra Wagenknecht (Kommunistische Plattform) suchte der Partei Wahrheiten einzuprägen, die von Oberen “vergessen” wurden. “Das Problem ist”, sagte sie, “wenn eine linke Partei sich hinstellt und erklärt: Wir müssen Sparpolitik machen, weil kein Geld da ist. Das stimmt so einfach nicht. Es gibt in diesem Land genügend Geld, und wenn die öffentlichen Haushalte bettelarm sind, dann das hat etwas mit politischen Entscheidungen zu tun... Schröder hat im letzten Jahr großen Konzernen 25 Mrd. € Körperschaftssteuer geschenkt... Sie haben nicht nur nichts bezahlt, sondern sich mehr vom Finanzamt zurückgeholt, als überhaupt an Körperschaftssteuer erhoben wurde.” Eine linke Partei müsse darauf verweisen, dass es keinen Grund für unsoziale Sparprogramme gibt. Zudem existierten Projekte, auf die zu verzichten in der Tat nutzbringend wäre, etwa auf Scharpings Airbusse, den Autobahnausbau und die Übernahme von Kreditrisiken aus der Berliner Bodenspekulation. Regieren oder Nichtregieren sei eine pauschale Frage; viel mehr komme es auf Inhalte und Konditionen an. “Es gibt kein Naturgesetz, das linke Parteien auf Anpassungskurs zwingt. Von den politischen Entscheidungen der PDS wird es abhängen, ob der wieder unverfroren kriegslustige und sozial immer weniger erträgliche deutsche Kapitalismus weiterhin mit einer einflussreichen sozialistischen Partei rechnen muss oder nicht.”
Harald Werner, gewerkschaftspolitischer Sprecher im PDS-Vorstand, riet davon ab, “das Geschäft der Mangelverwaltung und des drastischen Sparens hinter verschlossenen Türen” zu besorgen. “Wer aber die Betroffenen an der Problemlösung beteiligt, der löst gleich drei Aufgaben auf einmal. Erstens lenkt die schonungslose Aufdeckung aller Ursachen und Bedingungen den Zorn auf die richtigen Leute, zweitens erschließt die Beteiligung der Betroffenen ein ungeahntes Potenzial an Kreativität und drittens ist das Verfahren nicht nur demokratischer, sondern trägt auch zur Politisierung vieler Menschen bei. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Ver.di in Thüringen, Angelo Lucifero, rügte die PDS deswegen, weil sie nicht als treibende linke Kraft wirkt. “Ist die PDS auf dem Weg zu einer sozialdemokratischen Partei? Ich würde sagen, sie ist auf dem Weg zur SPD. Eine sozialdemokratische Partei wäre eine Partei, die versucht, Schritt für Schritt die Verhältnisse zu verändern.”
Rund 200 PDS-Mitglieder und —Sympathisanten aus der ehemaligen DDR, darunter einst Prominente, wandten sich mit einem Offenen Brief an die Rostocker Parteitagsdelegierten. Darin übten sie an der Präambel und am unsozialen Inhalt der Berliner Koalitionsvereinbarung Kritik und erklärten, gleich vielen GenossInnen seien sie “über eine Politik beunruhigt, die nicht mehr erkennen lässt, dass sie als Fernziel eine sozialistische Gesellschaftsordnung erstrebt. Selbst eine Reformpolitik gegen die neoliberale und militarisierte Gangart des Kapitalismus wird zunehmend konturlos. Die Verfolgung einer konsequenten Opposition — außerparlamentarisch und parlamentarisch — und des sozialistischen Ziels ist jedoch ein wesentliches Motiv für die Mitgliedschaft vieler in der PDS und ebenso für ihre Unterstützer. Ein Verlassen der geltenden Programmgrundsätze brächte die Partei um ihre sozialistische Identität. Die weitere Entwicklung der PDS, deren politische Praxis und auch die Programmdebatte, muss dem Rechnung tragen. Wir appellieren an die Delegierten..., unsere Überlegungen in ihre Entscheidungen einzubeziehen.”
Kongress der Schaumschläger
Der Rostocker Parteitag am 16./17. 3. 2002, genauer gesagt die dritte Tagung des 2000 in Cottbus eröffneten, 2001 in Dresden fortgesetzten 7. PDS-Parteitags, ignorierte den Offenen Brief. Er setzte sich weder mit der skandalösen, die Organisation belastenden Kapitulation vor dem Establishment in Berlin, noch mit anderen prinzipiellen Fragen auseinander. Vertreter des tonangebenden rechten Flügels warben für weitere Regierungsbeteiligungen. Linksstehende Delegierte, unter ihnen Wagenknecht, Uwe-Jens Heuer und Ekkehard Lieberam, legten dar, was sie am gegenwärtigen Kurs und am Wahlprogrammentwurf störe. Auch sie übten keine Grundsatzkritik. Ein Grund dafür war die Parteitagsregie, von der Bundestagsfraktionsvorsitzender Roland Claus behauptete, dass es sie gar nicht gebe. Sie schränkte Zeit und Zahl von Diskussionsbeiträgen rigoros ein. Bei 119 Anträgen und 545 Vorschlägen, die dem Kongress unterbreitet wurden, hätte es 48 Stunden gedauert, bis jeder von ihnen fünf Minuten lang begründet war. Auch nach erheblicher Reduzierung der Anträge wären mehr als zehn Stunden Redezeit für Delegierte erforderlich gewesen. Diese wurde auf eine zweistündige Generaldebatte und knapp sechs Stunden Antragsberatung herabgesetzt. Die Delegiertenmehrheit war im alten SED-Sinne diszipliniert und wies sämtliche über das vorgegebene Limit hinaus reichenden Vorschläge zurück. So die von Klaus-Rainer Rupp erhobene, von Heinrich Fink unterstützte Forderung nach sofortigem NATO-Austritt, die nach einem strikten Nein zum sogenannten Zuwanderungsgesetz und nach vollem Lohnausgleich bei Arbeitszeitkürzungen.
Der Parteitag bekundete demnach Treue zur “Realpolitik”. Jedoch enthielten das Bundestagswahlprogramm, die Reden der Vorsitzenden Zimmer und teilweise auch des Wahlkampfleiters Bartsch soviel oppositionelle Glanzlichter, dass manche Delegierten davon beeindruckt waren. Die “Glanzlichter” standen im Gegensatz zu der in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt praktizierten Politik und stellten einen weiteren Grund für den reibungslosen Ablauf des Parteitags dar. Durch sie wurde er zu einem Kongress der Schaumschläger.
Gabriele Zimmer wetterte über GenossInnen, welche “die ‚reine Lehre’ über widersprüchliche politische Handlungsmöglichkeiten” stellten und in der Präambel zur Berliner Koalitionsvereinbarung nicht die Chance sähen, “endlich mit der SPD dazu in einen Diskurs treten zu können”. Sie verwandte sich andererseits dafür, in Berlin “noch mehr außerparlamentarischen Druck aufzumachen” — so als ob es solchen dort schon gegeben hätte — und plädierte für den nach Brecht “plebejischen Blick” des Sozialismus von unten, der einen vor Korrumpierbarkeit nach SPD- und Grünen-Art bewahre. Obgleich der Prozess dazu längst im Gange ist, versprach sie, “nie unsere Grundpositionen” preiszugeben. Zimmer bat um einen “super-engagierten” Bundestagswahlkampf und versicherte: “Wir können alle rückhaltlos um jede Stimme kämpfen, denn niemand muss Angst haben, gegebenenfalls Bundesministerin oder Bundesminister werden zu müssen.” SPD, Grüne und das gesellschaftspolitische Kräfteverhältnis seien dafür noch nicht reif. Die Rednerin bekundete Sympathie mit der internationalen Bewegung gegen die neoliberale Vorherrschaft. Die verheerende “uneingeschränkte Solidarität” mit den USA, welche bisher nur die Beteiligung der BRD am Krieg eingebracht habe, müsse aufgekündigt werden. Zimmer teilte mit, zusammen mit fünf anderen Spitzenvertretern europäischer Linksparteien eine internationale Schutztruppe unter UNO-Ägide für die Zivilbevölkerung im Nahen Osten angeregt zu haben, damit dort der Ausstieg aus der gegenseitigen Gewaltanwendung beginnen könne. Sie verwandte sich für den Wahlprogrammentwurf und eine Resolution zur Besteuerung auch von Vermögenden. Es gelte zu beweisen, “dass wir die linke Kraft in Deutschland sind, die sozialistische Partei, die sich viele Menschen so dringlich erhoffen”.
Dietmar Bartsch bekräftigte das Ziel, bei der Bundestagswahl im September den dritten Platz zu erringen. Entgegen sonst geäußerten Ansichten erklärte er: “Der gegenwärtige Regierungskurs kann durch uns nur mit einem beantwortet werden: mit klarer Opposition!” Bartsch begründete die Nichtaufnahme offen antikapitalistischer und die NATO-Auflösung propagierender Punkte im Wahlprogramm, weil dieses nur für die nächste Legislaturperiode gelte. Tatsächlich werden darin durchaus Forderungen gestellt, die über 2006 hinausgehen. Im Hinblick auf Berlin bezeigte der Redner Dienstbarkeit den Herrschenden gegenüber und schob dazu die Wähler vor. Diese, so Bartsch, “haben uns beim Wort genommen... Ja, wir müssen auslöffeln, was andere eingebrockt haben. Es ist keine Politik, einerseits die Veränderung der Welt zu propagieren, aber andererseits zu meinen, den Dreck vor der eigenen Haustür mögen andere wegfegen, am besten die, die ihn hinterlassen haben. Also, Genossinnen und Genossen: Nehmen wir die Chance — in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern — an!” Vom Verursacherprinzip hat der Wahlkampfleiter offenbar nichts gehört. Zudem ging er mit keinem Wort darauf ein, dass die Wähler von der PDS eine andere Politik und nicht den Einsatz als Kehrmaschine gewollt haben. Die “Chance” solchen Einsatzes könnte nur der weitere Niedergang der PDS sein.
Das Programm zur Bundestagswahl trägt den Titel “Es geht auch anders: Nur Gerechtigkeit sichert Zukunft!” In der nachgereichten Präambel heißt es, die Partei scheue nicht den kleinen Schritt und den historischen Kompromiss. Sie halte fest an dem Ziel, wirkungsvoll zu einem Mitte-Links-Bündnis beizutragen. “Aber es gibt keine Ziele, derentwegen sie ‚Ja’ sagen würde zu einer Beteiligung an Kriegspolitik. Es gibt keine Koalition, derentwegen sie ‚Ja’ sagen würde zur Fortsetzung einer Politik der sozialen Kälte. Es gibt kein Argument, wegen dessen sie bereit wäre, sich mit dem Abbruch demokratischer und freiheitlicher Rechte abzufinden... Deshalb kann es für die PDS gegenwärtig keine andere Entscheidung geben: Sie geht als oppositionelle Partei gegenüber der jetzigen Regierungspolitik und den allzu ähnlichen konservativen Alternativen in den Bundestagswahlkampf 2002 und in die neue Legislaturperiode.”
In den ersten drei Abschnitten tritt die PDS für Schaffung neuer Arbeitsplätze u. a. durch Verringerung der Arbeitszeit und einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, für eine Besteuerung nach Leistungsfähigkeit und die Ausnutzung der EU-Osterweiterung als Chance ein, Ostdeutschland zu modernisieren. Das Sozialstaatsprinzip soll erneuert, es sollen finanzielle Grundsicherungen für Beschäftigte, Arbeitslose und Kinder eingeführt und der Einfluss der Pharmaindustrie auf das Gesundheitswesen zurückgedrängt werden. Im vierten Abschnitt verlangt die PDS, Voraussetzungen zur Nutzung des Internet durch alle Bürger zu schaffen und die Bildungsausgaben mindestens auf das Durchschnittsniveau der OECD anzuheben. Sie betont im fünften Abschnitt die Verteidigung des Grundgesetzes, propagiert das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürger mit über fünfjährigem deutschem Wohnsitz und die Aufhebung der Fünf-Prozent-Sperrklausel. Die Partei setzt sich nicht für die Wiederherstellung der Verfassung in den Punkten ein, in denen sie wie beim Notstands- und Asylrecht zum Negativen hin verändert wurde. Der Unterabschnitt zum Rechtsextremismus ist allgemein gehalten. Er sagt nichts über die Förderung extremer Reaktionäre durch Staat und Justiz und den erforderlichen Kampf dagegen aus. Im sechsten Abschnitt werden die Stärkung von UNO und OECD, Einsatz Deutschlands für eine demokratische Kontrolle internationaler Finanzströme, die Zurückdrängung der Macht internationaler Konzerne und Freigabe von Patentrechten für Produkte der menschlichen Grundversorgung verlangt, ferner Schuldennachlässe zugunsten von Entwicklungsländern, Nichtbeteiligung am neuen strategischen Konzept der NATO und eine Bundeswehrreform, wobei die Armee auf höchstens 100 000 Mann zu begrenzen wäre. Der siebte und letzte Abschnitt über die PDS selbst trägt deklamatorischen Charakter.
Am zweiten Beratungstag befasste sich Bundestags-Fraktionschef Claus in seinem Referat mit PDS-Vorstellungen zu einer Steuerreform. Er verwies darauf, dass die großen Unternehmen nur noch mit 1,5 Prozent am Gesamtsteueraufkommen beteiligt sind, Lohnsteuereinnahmen aber 30 Prozent ausmachen. Claus forderte einen Übergang zu echten Vermögenssteuern und die Einführung der Tobinsteuer auf Spekulationsgewinne.
Mecklenburg-Vorpommerns Vizeministerpräsident Helmut Holter begründete den Antrag “Gerechtigkeit, Entwicklung, Integration — für einen starken Osten im Herzen Europas”, den der Parteitag bei vier Gegenstimmen und sechs Enthaltungen annahm. Er stimmt inhaltlich mit Teil zwei des Wahlprogramms überein, ist aber wesentlich detaillierter als dieser. Vorgeschlagen wird eine “europäisch ausgerichtete sozial-ökologische Modernisierungswelle für Ostdeutschland” und das an Tschechien grenzende Ostbayern. Das zu modernisierende Gebiet soll als “Sprungbrett nach Osteuropa” genutzt werden. Dabei wären ostdeutsche Erfahrungen in die neuen EU-Länder zu exportieren und zwischenstaatliche Kooperationsbeziehungen herzustellen. Ein “Verkehrsprojekt Osterweiterung” solle dem Ausbau der Schienen- und Straßenwege dienen. Zugleich sind gemeinsame Bildungsprojekte mit Polen und Tschechien beabsichtigt.
Die Geschichte von 1989/90 wird in dem Papier dahingehend uminterpretiert, dass die DDR-Bürger die Reformierung ihres Landes “und schließlich die Vereinigung mit der Bundesrepublik auf friedliche Weise von unten herbeigeführt” hätten. (!) Erst dann sei der Prozess “vor allem von oben und von West nach Ost verlaufen”. Anschließend heißt es, die PDS wolle erneut demokratischen Bewegungen und Bürgerinitiativen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung sichern. Sie sei für eine von Bund und Ländern zu unterstützende Innovations-, Investitions- und Gründungsoffensive, gezielte Förderung ostdeutscher Unternehmer und umweltfreundliche Reindustrialisierung. Die Partei fordert dazu ein “Aktionsbündnis Ost für Arbeit, Aufträge und Unternehmensansiedlung” aus Bund, Ländern, Banken und Unternehmen, an dem auch Gewerkschaften, Arbeitslosen- und regionale Initiativen teilhaben. Das gleichermaßen staatliche und privatkapitalistische Großprojekt erinnert an den Rooseveltkurs der 30er Jahre, aber auch an Volks- und Nationale Front. Es trägt in hohem Maß utopische Züge. Zur Planung des Gesamtprojekts sei “eine Art Beauftragter für die Ostregion” zu installieren. Wirtschaftsförderung soll künftig über die stille Beteiligung der öffentlichen Hand an Unternehmen und Unternehmensnetzwerken geschehen. Zugleich werden wieder Angleichung der ostdeutschen Löhne, Gehälter, Arbeitszeiten, Renten- und Versorgungsansprüche an das Westniveau sowie finanzielle Stärkung der ostdeutschen Kommunen verlangt.
Neben diesem Papier und dem Wahlprogramm beschloss der Parteitag eine bundesweite Kampagne gegen die anhaltende und z. T. beschleunigte Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben. Er forderte eine erneuerte Vermögenssteuer und die Tobinsteuer. Weitere Resolutionen galten der Unterstützung der Betriebsratswahlen — auch durch Initiativen zu mehr Mitbestimmung in Unternehmen und Beseitigung des Antistreikrechtsparagraphen — sowie der laufenden Tarifrunde. Die Behindertenpolitik solle von Diskriminierungselementen befreit werden. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern möge sich die Partei innerhalb der Länderkoalitionen um positive regionale Änderungen am von ihr im Bundestag abgelehnten “Zuwanderungsgesetz” bemühen. Außenpolitisch plädierte der Kongress für Stellungnahmen der Bundesregierung mit den anderen EU-Staaten gegen Washingtons Pläne zum Einsatz atomar bestückter Raketen, Granaten und Minibomben als Angriffswaffen gegen Länder, deren Kurs den USA nicht genehm ist. (Disput 3-02 und Pressedienst 12/13, Sonderausgabe “Rostocker Parteitag der PDS”)
Sofort nach dem Parteitag unternahm Helmut Holter einen neuen Vorstoß, um die PDS weiter ins staatstragende Lager zu drängen. Gegenüber der “Berliner Zeitung” vom 18. 3. 2002 kritisierte er die Absage an ein Zusammengehen mit SPD und Grünen nach der Wahl vom 22. 9.: Es gebe auch außenpolitische Kompromissmöglichkeiten. Die PDS müsse anerkennen, dass Deutschland in der NATO sei und an Militäreinsätzen mit UN-Mandat teilnehme. Holter motivierte seine Äußerungen damit, dass das militärische Engagement ohne Mitregieren der PDS weiter ausgebaut und verschärft werden würde.
Wohl um neuen innerparteilichen Auseinandersetzungen vorzubeugen, trat ihm Europaabgeordneter André Brie entgegen. Er konstatierte, dass sehr viele Wähler “nicht nach Regierungsbeteiligung der PDS, sondern nach einem realistischen, aber unmissverständlichen Nein zur uneingeschränkten Unterstützung der verantwortungslosen und zerstörerischen Politik der USA dürsten”. Brie warnte davor, den Weg der Grünen zu gehen, die für Teilnahme an der Regierung ihre eigenen Wurzeln gekappt hätten.
Glorreiche Rettung der “Schweinefonds”
Nicht nur Holter, auch andere PDS-Führer hielten nach Rostock am Kurs der Einpassung ins bundesdeutsche Herrschaftsgefüge fest. Am 9. 4. 2002 stimmte die Berliner Abgeordnetenhausfraktion zusammen mit jener der SPD für ein Ermächtigungsgesetz, wonach der Senat mit 21,6 Mrd. € binnen 30 Jahren für Risiken oft obskurer und krimineller Risikogeschäfte der privaten Bankgesellschaft Berlin AG (BGB) haftet. Um den Bankrott dieses Unternehmens abzuwenden, soll die von ihm mit ruinierte Stadt ab 2003 vorerst 300 Mill. € pro Jahr an die BGB entrichten — eine Summe, die annähernd dem Kulturetat der Stadt entspricht. Die Alleinverfügung über das Geld hätte die Bankgesellschaft.
Die Geschichte dieser Gesellschaft lief wie folgt ab. Während bundesdeutsche Großkonzerne zu Beginn der 90er Jahre mit staatsmonopolistischer Unterstützung durch die Treuhand die Industrie der früheren DDR abwrackten und plünderten, heckten CDU-Machthaber in Berlin, vor allem Eberhard Diepgen und Fraktionschef Klaus Landowsky, mit ihren Finanzexperten und Rückendeckung des Koalitionspartners SPD ein anderes Projekt aus, schnell zu möglichst viel Geld zu kommen. Dazu veranlasst sahen sie sich durch den Abbau der milliardenschweren Bonner Berlinförderung ab 1991 und den zur selben Zeit einsetzenden, mit Überteuerung und enormen Spekulationen verknüpften Bauboom in der sich wieder zur deutschen Hauptstadt mausernden Großgemeinde. Resultat war die private Berliner Bankgesellschaft. Sie kam allerdings erst 1994 zustande, als besagter Boom zu Ende ging. Doch hatten die Gesellschaftsplaner auch für diesen Fall vorgesorgt. Ihre Schöpfung, die sich zur Holding Bankgesellschaft Berlin AG entwickelte, war eine für Deutschland ungewöhnliche Konstruktion. Ihr unterstanden sowohl weitere profitorientierte Geldinstitute — Berliner Bank, Berlin-Hannoversche Hypothekenbank (Berlin Hyp, Vorstandsvorsitzender: Landowsky) und Allbank -, als auch die vom Senat kontrollierte, öffentlich-rechtliche Landesbank Berlin mit den Sparkassen. Der Stadtstaat blieb stets Mehrheitsaktionär der BGB — erst mit über 50, seit August 2001 mit 80,95 Prozent Anteil. Allerdings wirkte sich die scheinbar dominante Position nicht zu seinem und der Berliner Bürger Gunsten, sondern zu deren Schaden aus. Die zur Konstruktion gehörenden Institute mit ihren Unterabteilungen waren unterdes durch Verträge diverser Art miteinander verwoben worden.
Die Leiter des Konzerns und ihre Hintermänner hatten Rosinen im Kopf. Sie wollten nicht allein den Bauboom neu entfachen, obwohl es hierzu keinen Anlass mehr gab, sondern auch Berlin zur “Dienstleistungsmetropole”, “Olympia-Stadt” und “Ost-West-Drehscheibe”, zudem zu einem Bankenstandort vom Range Frankfurt/Mains entwickeln. Das hiervon abhängige Geschäftsgebaren der Herren bloß eigenartig zu nennen, hieße stark untertreiben. Bei hohen Geldeinlagen räumte die BGB Konditionen wie niemand sonst ein. Sie konnte das dank der schon damals gegebenen, wenngleich illegalen Rückendeckung von öffentlich-rechtlicher Seite her, zu der es kam, obwohl das Abgeordnetenhaus, das sie hätte genehmigen müssen, nie darum gebeten worden war.
Waren schon die über 50 regulären Immobilienfonds der Bankgesellschaft ungemein lukrativ — allerdings nur für Kunden, die mindestens 150 000 Mark einzahlten -, so sprengten die drei nicht öffentlichen Prominentenfonds alle Gewinnrekorde. Hans-Georg Lorenz, Mitglied des Abgeordnetenhauses und des Donnerstagkreises der “Vereinigten Linken in der Berliner SPD”, bezeichnete sie als “Schweinefonds”. Fonds 9 der LBB garantierte bei entsprechend hoher Einlage 87 Prozent Steuerersparnis, Fonds 8 noch ein Prozent mehr. Im erstgenannten Fall brauchte einer für den 100 000-DM-Anteil nur 54 000 Mark zu berappen, erhielt er doch die restlichen 46 000 vom Finanzamt zurück. Zugleich war ihm für die folgenden 29 Jahre ein Zins von 12, später 15 Prozent sicher, heimste er nach Lorenz’ Berechnungen insgesamt 315 000 DM ein. In anderen Fällen konnten Prominente 200 Prozent Steuerersparnis durch sogenannte Verlustzuweisungen erzielen. Beim Kauf von Fondsanteilen für 2 Mill. DM auf Kredit erhielten sie eine Steuerrückzahlung in gleicher Höhe. Dazu kamen 29 Jahre lang die hohen Zinsen — alles bei einem Geschäft, in das kein Pfennig eigenes Kapital geflossen war. Kein Wunder, dass sich vor allem die “Schweinefonds” bei einzahlungsberechtigten Prominenten großer Beliebtheit erfreuten und beispielsweise sowohl SPD-Landesvorsitzender Strieder, als auch Justizministerin Däubler-Gmelin an der Fondsbildung beteiligt waren — es derzeit wohl noch sind. Bankhäuser aus allen Teilen der Bundesrepublik dienten der BGB profitträchtig ihre riskantesten Projekte an.
Obwohl das Landesarbeitsgericht Berlin 1996 die Praktiken dieser Firma für verfassungswidrig erklärte, dauerten sie so lange ungestört fort, bis 2001 ein Kapitalminus von 4 Mrd. DM festgestellt wurde. Vorher war deshalb alles gut gegangen, weil dank der hohen Zinsleistungen immer wieder frisches Kapital hereinkam. Daher konnten auch ständig neue Geschäfte, etwa Bodenkäufe zu überhöhten Preisen, z. T. auf Vorrat, garantierte hohe Mieteinnahmen auch dann, wenn der neue Wohnraum nicht oder nur ungenügend genutzt wurde, Anlagen bei Holzmann und Herrlitz und verlustreiche Bodenspekulationen in Irland getätigt werden.
Der Crash von 2001 schadete dem Berliner Staatssäckel, da das Land die Kapitallücke mit 1,7 Mrd. € auffüllte. Es schadete auch dem Ansehen einiger Regierender. Landowsky und Diepgen, dazu einige Banker wie BGB-Chef Wolfgang Rupf (der Mann heißt wirklich so!) mussten den Hut nehmen. Sie bekamen den Abgang durch hohe Pensionen, teilweise auch Abfindungen versüßt und wurden juristisch-finanziell nicht zur Rechenschaft gezogen. Die minder belastete SPD konnte sich der Mitverantwortung entziehen. Nach Bildung einer Übergangsregierung mit den Grünen sorgten beide Partner dafür, dass Abgeordnetenhaus und Senat noch die Risikohaftung für BGB-Immobilienfonds übernahmen.
Vor erneutem Eingehen auf die aktuelle Lage ein Blick auf die von der Bankgesellschaft mitverursachte generelle Finanzmisere Berlins! Die städtischen Schulden wuchsen 1994-Ende 2000 von 30 auf 80 Mrd. DM, d. h. auf rund 40 Mrd. €. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre versuchte Finanzsenatorin Annette Fugmann-Heesing (SPD), den Schuldenberg mit Thatcher-Methoden abzubauen. Durch Privatisieren der Gas-, Strom- und Wasserversorgung sowie von Wohnungsgenossenschaften, vielfach zu herabgesetzten Preisen, wurde 1996/98 ein Betrag von 10 Mrd. Mark erwirtschaftet. Gleichzeitig verringerten sich die Ausgaben für Investitionen auf 4 Mrd. Mark, wurden 35 000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst liquidiert. Folge waren ein immer katastrophaler werdender Schulnotstand, die Schließung von Krankenhäusern, Jugend-, Freizeit- und wissenschaftlichen Einrichtungen. Das Lohnniveau sank, die Gebühren stiegen. Bei der Erwerbslosen- und Armutsquote erreichte nun auch Westberlin ostdeutschen Standard. Der Schuldenberg indes wuchs weiterhin.
Die Wahl am 21. 10. 2001 trug der CDU die wohlverdiente Abfuhr ein, verschonte aber die SPD. Sieger wurde die bisher unverbrauchte PDS, die nun mit Gysi, Knake-Werner und Flierl ins Senatsgeschäft einstieg. Statt wie versprochen dringende Änderungen in der Mittelverteilung zugunsten von Bildung und Kultur herbeizuführen oder gar nach Roland Claus’ Prophezeiung die Stadt “von den Banken zurückerobern” zu helfen, stellten sich die Parteigrößen in deren und Klaus Wowereits Dienst. Sie wirkten unter dem Regierenden Bürgermeister und Finanzsenator Sarrazin tatkräftig am neuerlich forcierten Personal- und Sozialleistungsabbau und an der Absicherung fortdauernder Schwindelgeschäfte zu Lasten der Berliner mit.
Vor der teils öffentlichen, teils wegen eventueller Erwähnung von Bankgeheimnissen geschlossenen Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am 9. 4. 2002 wurde in Presse- und Redebeiträgen auch die Stimme der Vernunft und sozialen Verantwortung laut. SPD-Abgeordneter Lorenz verdeutlichte, dass es neben dem von den Koalierten beantragten Blankoscheck für die Bankgesellschaft und ihre 70 000 Fondsinhaber zwei andere, den 3,5 Millionen Berlinern und den Finanzen ihrer Stadt zuträglichere Möglichkeiten gab. Erstens den Bankrott der BGB als Konzern — dann müssten die Kapitalgeber haften und nicht das Land Berlin. Zweitens Garantien für die Einlösung von Verpflichtungen der öffentlich-rechtlichen Landesbank, nicht aber der privaten Banken und Immobilientöchter. Letztgenannte solle man “notfalls untergehen lassen und dann sehen, welche Ansprüche... sich tatsächlich als solche erweisen, die das Land Berlin erfüllen muss”. Prinzipiell gab Lorenz zu bedenken: “Ein Staat, der nicht in der Lage ist, diejenigen, die seine Hauptstadt ruinieren, wenigstens zur Verantwortung zu ziehen und mit ihrem Privatvermögen haftbar zu machen, wird in seiner Funktion für die Menschen nicht mehr sichtbar. Dass die Reichen und Mächtigen die Armen ausplündern, dazu bedarf es keines Staates. Das dem Abgeordnetenhaus vorliegende Gesetz will die Bank schützen — und plündert dafür die Gesellschaft. Wenn es uns nicht gelingt, solche kriminellen Machenschaften für die Zukunft auszuschließen..., wird das Vertrauen der Bürger gänzlich schwinden... Gelingt es nicht, das zu verhindern..., stellt sich die Systemfrage.” “Wenn die Herrschaft über den Haushalt letztlich von den Banken ausgeübt wird, macht sich das Parlament überflüssig.”
In einem vor der Abstimmung geschriebenen Artikel gab der “Freitag” Nr. 16/2002 zu bedenken, dass die Berliner SPD-Führung als Mittäter nicht für Bereinigung und Aufklärung der Affäre sei. “Warum aber beteiligt sich die bislang schuldlose PDS an diesem kollektiven Wahnsinn der politischen Klasse? Statt sich hilflos und schweigend einer vermeintlichen Staatsräson hinzugeben, die in Wahrheit aus Lug und Betrug besteht, sollte sie den Bruch der frischen Koalition in Kauf nehmen und mit klaren Positionen an die Öffentlichkeit gehen: Abwicklung der Bankgesellschaft als Holding und Rettung der sanierungsfähigen Töchter; ordentliche Abfindung für die Bankangestellten, deren Arbeitsplatz nicht zu halten ist; Ausschöpfung der juristischen Mittel gegen die Verantwortlichen; Haftung mit Landesmitteln nur dann, wenn die Rechtmäßigkeit von Geschäften zweifelsfrei nachgewiesen ist. Die PDS sollte im Verein mit den Bürgern die letzten Reste des Rechtsstaates, der Demokratie und der sozialen Verantwortung gegen die Plünderer öffentlicher Kassen verteidigen.” Eine demokratisch-sozialistische, nicht der Abzockergesellschaft verpflichtete Partei hätte das getan. Ist die PDS noch so eine Partei?
Probeabstimmungen ihrer Abgeordneten am 8. 4. ergaben keine Mehrheit zur Annahme des Ermächtigungsgesetzes. In der SPD-Fraktion waren drei Abgeordnete dagegen — Lorenz, Ulrike Neumann und ein zur Stimmenthaltung entschlossener Parlamentarier. Gysi und Wowereit boten ihre ganze beträchtliche Überredungskunst auf, dem Gesetz die Annahme zu sichern. Gleichzeitig wirkten die Banken auf die Volksvertreter ein. Ihre von den Partei- und Fraktionschefs der Koalition und deren Experten mitverbreitete Argumentation besagte, es gebe zur Absicherung der BGB-Fonds keine Alternative. Beim größten deutschen Firmenbankrott seien 14 000 Arbeitsplätze gefährdet. Da die einzelnen Teile der Konstruktion viel zu fest verwoben seien, würde die Nichtannahme des Gesetzes auch den Sparkassen und ihren Kunden schaden. Tausende mittelständische Betriebe gingen pleite. Warum dies Horrorszenario Wirklichkeit werden sollte, wurde nicht erklärt, das Szenario aber lautstark hinausposaunt. Nirgendwo kam die Frage auf, ob die 21,6 Mrd. €, die zwecks Risikohaftung zu Lasten der Steuerzahler in den Rauch geschrieben werden sollten, nicht zur Rettung und Beschaffung von Arbeitsplätzen, zur Abwendung nicht selbst verursachter Bankrotte kleiner Unternehmer verwendet werden könnten. Banker und Parteiobere stellten sich mit ihrer Version als allwissende Autoritäten dar, denen der gemeine Abgeordnete brav zu folgen hat. Sie fanden bei vielen ihrer Schäfchen Anklang.
Um das Ermächtigungsgesetz durchzudrücken, war am 9. 4. noch die Stimmenthaltung der CDU vonnöten. FDP und Grüne hielten ihre Westen rein, indem sie dagegen stimmten. Die SPD entschied sich so wie bei der Probeabstimmung. Bei der PDS votierte nur, wie vorher angekündigt, Freke Over gegen den bislang tiefsten Fall der Partei. Er wollte nicht den Angaben der Profiteure des Schwindelunternehmens und ihrer Papageien folgen und stellte die unbeantwortet bleibende Frage, wie viele Mitglieder des Abgeordnetenhauses an BGB-Fonds beteiligt wären. Eine PDS-Abgeordnete betätigte versehentlich die Neintaste.
Des Satire-Effekts wegen sei hier die Begründung Harald Wolfs für das Ja seiner Fraktion wiedergegeben. Er nannte die Entscheidung selbst pervers, doch sei sie “das kleinere Übel”. Der Fraktionschef schickte dem zwei leere Drohungen hinterher. Erstens die, dass Diepgen und Landowsky “aus ihrer Verantwortung nicht entlassen” würden. Zweitens eine des Inhalts, nun werde “das Aufmisten dieser Stadt von Filz und Korruption beginnen”, was nach deren mit PDS-Hilfe errungenen schönstem Sieg besonders überzeugend klingt. Im “Neuen Deutschland” vom 12. 4. behauptete Carl Wechselberg, Referent der Abgeordnetenhausfraktion für Haushalt und Finanzen, man habe dafür gestimmt, um einen “finanzpolitischen Super-GAU” zu verhindern, und dabei zugleich den hervorragendsten politischen Auftrag — die “Bewältigung des Erbes der Großen Koalition” — erfüllt.
Hochrangige “demokratische Sozialisten” haben inzwischen auch dazu beigetragen, das von Innenminister Schily weitgehend CDU/CSU-Vorstellungen angepasste sogenannte Zuwanderungsgesetz, dem sie im Bundestag die Zustimmung verweigerten, am 22. 3. 2002 erfolgreich durch den Bundesrat zu bringen. Ihr Preis dafür war das Versprechen der SPD-Partner in Schwerin und Berlin, einige Gesetzesbestimmungen regional nicht anzuwenden oder weniger hart auszulegen. Es bleibt bei der prinzipiellen Funktion des Paragraphenwerks, “Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern”, während die offizielle Parteiparole noch im Bundestagswahlprogramm “Offene Grenzen für Menschen in Not” lautet. Treffend hat der Christdemokrat Norbert Blüm das Gesetz als “neokapitalistisch” charakterisiert, weil wesentlich nur der Zweck verfolgt werde, Hochqualifizierte aus minderentwickelten Ländern heranzuholen.
Die PDS ist auf dem Weg zur systemkonformen, an neoliberaler Politik aktiv beteiligten Partei — dem in den Sumpf — schwerlich aufzuhalten. Ihre Reala- und Realo-Führer dominieren. Der zahlenmäßig noch relativ starke pazifistische Flügel hat sich durch die Zusage besänftigen lassen, weiter Antikriegspartei zu sein und nicht an der nächsten Bundesregierung teilzunehmen. Marxistisches Forum, Kommunistische Plattform usw. traten weder während des Parteitags in Rostock noch danach mit prinzipieller Kritik hervor.
Momentan ist die PDS tatsächlich noch die einzige Friedenspartei. Doch erweist ihre jüngste Geschichte, dass auch in diesem Fall Kräfte agieren, die das korrigieren wollen und regierungsnah sind. Haben sie Erfolg, gibt es nach meiner Meinung keine Chance mehr zu einem progressiven Kurs dieser Partei, erst recht nicht zu einem sozialistischen. Dann könnte für die linke Opposition im Lande eine Situation gegeben sein, in der es notwendig ist, sich unter Zurückstellung historisch bedingter Differenzen untereinander über die Schaffung einer basisdemokratischen neuen marxistischen Partei zu verständigen.
Sachsen-Anhalt und die Oppositionsinitiativen
So weit war dieser Artikel gediehen, als neue Ereignisse es notwendig machten, ihn fortzusetzen. Das waren einerseits die Ergebnisse der Landtagswahl am 21. 4. 2002 in Sachsen-Anhalt, andererseits die Entstehung eines Netzwerks ostdeutscher oppositioneller Initiativen in und bei der PDS.
In der vermeintlichen Gewissheit, auf der Siegesstraße zu sein, wurden einige Parteiobere vor dem Wahltag übermütig. Roland Claus nahm das Ministerpräsidentenamt in Magdeburg für sich in Anspruch, was dessen Inhaber Reinhard Höppner (SPD) als “absurde Kraftmeierei” abtat. André Brie sah sich veranlasst, die eigene Partei zur Bescheidenheit zu ermahnen, damit nicht das geplante Bündnis mit der SPD gefährdet werde. Der frischgebackene Mitregierer Berlins Gregor Gysi, noch immer stärkster Mann der PDS, peilte am 3. 4. eine alsbaldige Koalition mit Schröder und Fischer infolge der Sachsen-Anhalt-Wahl an. Er malte den CDU/CSU-Kanzlerkandidaten als größtmögliches Übel an die Wand und verlautbarte: “Eigentlich ist das Jahr 2002 noch nicht das geeignete Datum für die Beteiligung der PDS an einer Koalition auf Bundesebene, aber wir werden mit Sicherheit nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass Stoiber Bundeskanzler wird.”
Die Landtagswahl vom 21. 4. 2002 erwies sich vor allem für die SPD, aber auch für deren Unterstützerpartei als Pleite. Entgegen Medien-Kommentaren muss festgestellt werden, dass nicht das “Magdeburger Modell” der Tolerierung eines Minderheitskabinetts gescheitert ist, sondern die einseitig auf Bedürfnisse der Herrschenden ausgerichtete, voll auf Bundeslinie liegende Politik dieser Regierung und der sie unterstützenden Partei. Zwar rückte keine Schill-Gruppierung anstelle der 1998 erfolgreichen, inzwischen aber verbrauchten DVU ins Magdeburger Parlament ein. Doch verlor die SPD 15,9 Prozent ihres damaligen Wähleranteils von 35,9 Prozent und erlitt ihre bisher schwerste Niederlage. Die PDS kam auf 20,4 Prozent und überrundete den Tolerierungspartner. Sie blieb aber drittstärkste Partei, statt wie erwartet zweitstärkste zu werden. Dafür erhöhten sich die Anteile der CDU von 22 auf 37,3 und die der FDP von 4,2 auf 13,3 Prozent. Höppner musste zurücktreten, und diese beiden Parteien bilden die neue Landesregierung.
Das möglicherweise wichtigste Ergebnis war der enorme Anstieg der Nichtwählerzahl. Sie betrug in Sachsen-Anhalt 43,5 statt vordem 28,3 Prozent. Dies entspricht zwar einem Entwicklungstrend in allen führenden kapitalistischen Ländern. Doch ist zu berücksichtigen, dass viele der 43,5 Prozent Nichtwähler, vielleicht die meisten, der Urne nicht deshalb fern blieben, weil sie zum Hingehen zu bequem waren. Sie haben einfach alle Parteien ihrer Politik wegen satt. Nichtwähler und Wähler von SPD und PDS zusammengenommen machen etwa 77 Prozent der Wahlberechtigten aus. Sie haben der bisherigen Landesregierung und ihrem Partner gegenüber zumindest Gleichgültigkeit bekundet.
Die PDS erlitt bei der Wahl eine doppelte Niederlage. Erstens verlor sie die Anwartschaft auf herbeigesehnte Ministerämter, vielleicht gar den Posten des Regierungschefs. Zweitens geriet die mindestens von Gysi anvisierte Kabinettsbeteiligung im Bund in tödliche Gefahr. Die Aussichten für die gleichzeitig mit der Bundestagswahl anberaumte Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sind ungewiss. Einige Parteiführer, so die Bundesvorsitzende Zimmer, gaben einseitig der SPD die Schuld am Desaster. Andere redeten sich das Wahlresultat schön. Bundesgeschäftsführer Bartsch sprach von der sechzehnten Wahl in Folge, welche die PDS gewonnen habe. Er verwies auf ihren um 0,8 Prozent höheren Stimmenanteil, verschwieg jedoch, dass dieser nur wegen der enormen Nichtwählerzahl so groß war. 1998 gegenüber hat die Partei mehr als 57000 Wähler verloren, was die größte Einbuße zwischen zwei Landtagswahlen darstellt. Ihr Anteil bei den Jungwählern sank auf 17 Prozent. Im Überschwang tatsächlicher oder vorgetäuschter Zuversicht aber äußerte die Landtagsfraktionsvorsitzende Petra Sitte, jetzt müsse die SPD ihr die Oppositionsführerschaft zuerkennen, denn: “Bei Gleichstand zählt das Torverhältnis, und da sind wir besser.”
Ähnlich schlecht wie um die Aussichten der PDS-Spitzenvertreter auf mehr Regierungsposten ist es um die innerparteiliche Opposition bestellt. Es rührt sich bei weitem zu wenig. Streiter wie Winfried Wolf, die Kommunistische Plattform und das Marxistische Forum sind im wesentlichen inaktiv. Andererseits traten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen und Berlin sich als oppositionelle Marxisten verstehende neue Initiativen auf den Plan.
Konstantin Brandt, Monty Schädel, Karl Scheffsky und andere verabschiedeten eine Gründungserklärung der Marxistischen Opposition Mecklenburg-Vorpommerns, in der konstatiert wird, angesichts der Verstöße führender PDS-Vertreter gegen das geltende Parteiprogramm und angesichts der Übernahme von Begriffen bürgerlicher Parteien in Form und Inhalt sei es notwendig, “dem Opportunismus und Revisionismus mit aller noch vorhandenen Kraft entgegenzutreten und neue Kräfte zu sammeln”. Konstantin Brandt (Pinnow) und Ekkehard Lieberam (Leipzig) legten am 15. 4. unter dem Titel “Rückkehr zu Marx” Überlegungen zum innerparteilichen Opportunismus vor, die mit dem Satz enden, wichtig sei insbesondere, “dass die Marxisten in der PDS sich als eigenständige Kraft konstituieren, sich der zunehmenden politischen Demoralisierung widersetzen, ein überzeugendes und praxistaugliches Konzept sozialistischer Politik vorstellen und sich auch der von Pragmatismus und einem Schönreden des Kapitalismus geprägten Anpassung an die bürgerliche Politik unzweideutig entgegenstellen”. Ellen Brombacher (Berlin) und Anton Latzo (Langerwisch) sind seit Anfang Mai bemüht, Meinungen von Mitgliedern und Sympathisanten der PDS in der Krieg-Frieden-Frage zu ermitteln und zu dokumentieren, um die von Parteioberen angestrebte Aufhebung des Beschlusses von Münster gegen jede Militäraktion in fremden Ländern, auch eine von der UNO abgesegnete, zu verhindern.
Im Berliner Karl-Liebknecht-Haus wurde am 7. 5. ein offenes Netzwerk “Linke Opposition in und bei der PDS” gegründet. Es soll Stellungnahmen zur aktuellen Politik der Partei abgeben, besonders zu der ihrer Vertreter im Berlin-Senat, und das Eingreifen Linker in den Parteigremien koordinieren - zur Zeit gibt es nicht einmal Absprachen zwischen den Parteitagsdelegierten aus der Hauptstadt. Mitinitiator Sigurd Schulze forderte die Ausnutzung aller Möglichkeiten einer pluralistischen Partei für die eigene Arbeit. Andere Redner merkten an, selbst auf der unteren Ebene seien zwei Drittel oder mehr PDS-Mitglieder systemkonform. Lothar Schwarz betonte: “Es darf auf keinen Fall die Illusion geweckt werden, dass die PDS eine sozialistische Partei ist oder werden kann. Perspektivisch geht es darum, eine neue Partei aufzubauen.”
Die Initiativen könnten zur Beantwortung der Frage beitragen, ob die bislang stärkste linke Kraft und einzige Friedenspartei in Deutschland erhalten bleibt oder zerfällt, ob sie im letzterwähnten Fall durch eine neue Organisation ersetzt werden kann. Übereinstimmung über den einzuschlagenden Weg gibt es bisher nicht. Zudem liegt ein wichtiger Mangel darin, dass vorwiegend ältere sowie fast ausschließlich männliche Mitglieder und Sympathisanten hinter den Initiativen stehen. Prognosen, welche Aussichten diese haben könnten, sind momentan unmöglich.
B. M. / Mai 2002
Arbeiterstimme, Nürnberg, Nr.136, 31, Jahrgang 2002
Hintergrund, Osnabrück, 15. Jahrgang, Nr. II/2002