| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: PDS / Linkspartei | 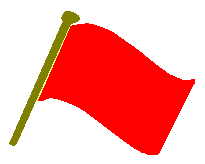 |
Mehr zum Aufruf zur Gründung einer neuen Linken:
Wie pluralistisch muß die neue Linke sein?
Joachim Bischoff, Richard Detje, Hasko Hüning und Björn Radke kritisieren am Gründungsaufruf Gysis und Lafontaines, daß er den von ihnen erhofften pluralen Charakter der zu fusionierenden neuen Linkspartei zu wenig betont[1]. Sie verweisen zugleich auf die eklektische und wenig stringente Analyse des Aufrufs, die mit dem Begriff "Raubtierkapitalismus" auf einen Nenner gebracht wird. Sie empfehlen stattdessen, bei der Einschätzung zu bleiben, daß es verschiedene Entwicklungspfade (nationaler) kapitalistisch verfaßter Gesellschaften gibt, die "zu erkämpfen sein werden" - was von Lafonine allerdings ganz genauso gesehen wird. Die von Ihnen angestrebte Zielsetzung bringen sie wie folgt auf den Punkt: "Das Projekt der Zivilisierung des Kapitalismus - durch eine Erneuerung sozialstaatlich-wirtschafts-demo-kratischer Entwicklung wie durch die Weiterentwicklung des Völkerrechts - ist ebenso wenig abgeschlossen, wie die Umwälzung der Rohstoffbasis und der Übergang zu nicht-fossilen Energieträgern."
Selten ist von reformistischen Ideologen die Quintessenz ihrer strategischen Zielsetzung so kurz und prägnant zusammengefaßt worden.
Das ermöglicht es jedoch zugleich, die Schwächen dieses Projekts in Kürze zu benennen:
- Bischoff und seine Mitstreiter übersehen die Kleinigkeit, daß die Weltwirtschaft keine Summe nationaler Volkswirtschaften ist, sondern im Gegenteil die Wirtschaftspolitik auf nationaler Ebene sowohl die weltwirtschaftlichen Entwicklungen wie auch auf auf nationaler Ebene ohne tiefgreifende Eingriffe in den Kapitalismus (auf nationaler Ebene) so gut wie nicht wesentlich beeinflußbare Rahmenbedingungen vorfindet und selbst die wesentlichen ökonomischen Parameter auf nationaler Ebene von der Weltwirtschaft direkt abhängig sind. Die Spielräume nationaler Politik sind daher außerordentlich eng, solange der Kapitalismus selbst und die damit einhergehende organische Integration in den kapitalistischen Weltmarkt nicht aufgehoben wird.
Es gibt deshalb keine Auswahl zwischen verschiedenen nationalen "Entwicklungspfaden", die je nach politischem Gusto beschritten werden können. Es ist die Weltwirtschaft, die umgekehrt die Möglichkeiten der jeweiligen nationalen Wntwicklung wie Politik bestimmt. Länder der imperialistischen Peripherie z.B. verfügen nicht über die materiellen Voraussetzungen für eine sozialstaatliche Entwicklung. Bischoff und seine Mitstreiter sollten zu Kenntnis nehmen, daß der Neoliberalismus keine spezifisch bundesdeutsche Marotte ist, sondern von allen führenden imperialistischen Staaten und ihren herrschenden Klassen als adäquate Antwort auf die aktuelle Entwicklungsphase des Imperialismus angesehen wird. Diese Tatsache wird auch nicht dadurch widerlegt, daß neoliberale Politik nicht überall mit der gleichen Härte und Konsequenz durchgesetzt werden kann. Die grundsätzlich gemeinsame Befürwortung dieser Politik durch die G7 ist ein starkes Indiz dafür, daß es schlicht utopisch ist, den Neoliberalismus abschaffen zu wollen und gleichzeitig zu beabsichtigen, den Kapitalismus unangetastet zu lassen. Es ist keineswegs eine "große Ironie der jüngsten Geschichte, dss in Europa die entscheidenden Reformen zugunsten der Aktionäre und Vermögensbesitzer von Mitte-Links-Regierungen durchgesetzt wurden", wie Bischoff in einem Interview mit dem ND erklärte[2]. Es ist zwangsläufiges Resultat einer Politik, die davon ausgeht, daß vor neuen Reformen in der Zukunft erst einmal die Stärkung des Kapitals erforderlich ist, um neue Verteilungsspielräume zu schaffen.
- Der Kapitalismus ist nicht "zu zivilisieren": In seiner Aufstiegsphase erreichte er seine Blütephase auf den Knochen der Kolonialvölker und durch die brutalen Formen der frühkapitalistischen Ausbeutung. Kaum war er in seine Reifephase gelangt, stürzte er die Menschheit in eine ununterbrochene Kette von Kriegen und in zwei Weltkriege. Auch während seiner sozialstaatlichen Phase nach dem Zweiten Weltkrieg wurden nahezu ununterbrochen neokoloniale Kriege geführt. Hinzu kommt, daß die kapitalistische Entwicklung die Menschheit in eine ökologische Katastrophe zu reißen droht. Der Sieg im Kalten Krieg hat weltweit nicht zu mehr Wohlstand und Frieden geführt, sondern neben der Konzentration von Reichtum in den Händen weniger zu mehr Massenelend und zu neuen Kriegsgefahren. Die durch die ungehemmte Entwicklung der kapitalistischen Ressourcenverschwendung verursachte Krise führt zu einer drastischen Verschärfung der Widersprüche des kapitalischen Weltsystems.
Wo Joachim Bischoff und seine Mitstreiter hier die Spielräume für die Zivilisierung des Kapitalismus sehen, entzieht sich jeder nachvollziehbaren Analyse. Politik wird durch Wunschdenken nach dem Motto Glaube, Blindheit, Hoffnung ersetzt.
- Die proklamierte Erneuerung sozialstaatlich-wirtschaftsdemokratischer Entwicklung ignoriert, daß der Kapitalismus nur insofern "sozial" ist, als es die jeweiligen nationalen Verteilungsspielräume des Kapitals zulassen. Historisch betrachtet sind sozialstaatliche Errungenschaften an Schönwetterperioden der imperialistischen Entwicklung gebunden, an seine Boomphasen. In Krisen- und Stagnationsphasen, sogar in Phasen nur tendentieller Stagnation, werden die Sozialstaaten durch Sparpolitik Schritt für Schritt ihres sozialen Scheins entkleidet. Der nackte bürgerliche Klassenstaat kommt zum Vorschein.
- Diese Perioden, in einer solchen befinden wir uns, sind gekennzeichnet durch verschärfte gesellschaftliche Widersprüche, immer wieder aufbrechende offene Klassenkämpfe, Aufrüstung und Kriegsgefahren. Die weltpolitische Realität ist deshalb auch nicht gekennzeichnet durch eine progressive Weiterentwicklung des Völkerrechts und durch die Stabilisierung einer internationalen Friedensordnung, sondern durch eine regressive Entwicklung des Völkerrechts. Es finden sich genügend Völkerrechtler, die den imperialistischen Staaten im Namen der Verteidigung der vorgeblichen Durchsetzung des humanitären Völkerrechts das Recht zur Führung von Angriffskriegen zubilligen wollen und sich so als Kriegspropagandisten betätigen.
- Bischoff, Radke & Co. rettet auch nicht der Hinweis, daß sie ihre Ziele ja erkämpfen wollen. Sie ignorieren nämlich standhaft, daß die wichtigsten sozialstaatlichen Errungenschaften den herrschenden Klassen der imperialistischen Staaten nicht abgerungen wurden durch Reformisten, sondern durch die damals noch revolutionär gesinnte Arbeiterklasse. Die Bourgeoisie hatte die wichtigsten Zweige unseres Systems der sozialen Sicherung eingeführt, um der revolutionären Arbeiterbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen - leider mit tendentiellem Erfolg. Diese Grundlagen des heutigen Sozialstaats sind daher in erster Linie die Errungenschaften des revolutionären Flügels der Arbeiterbewegung, nicht der Reformisten. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die wesentlichen Zugeständnisse der herrschenden Klasse in den meisten imperialistischen Ländern von konservativen Regierungen eingeführt, um angesichts der Systemkonkurrenz und des Kalten Krieges im Innern einen Burgfrieden zu ermöglichen. Was also soll "erneuert" werden? Allein während der Kanzlerschaft Willy Brandts wurden einige substantielle sozialstaatliche Reformen durchgesetzt. Das war der wirkliche Grund dafür, daß er schnell wieder gehen mußte.
Der Hinweis auf das den Reformisten so teure skandinavische Modell dient den Reformisten nur als Legende, um den bürgerlich-imperialistischen Sozialstaat propagandistisch als ihr ureigenstes Projekt zu verkaufen. In Wirklichkeit haben sich die Sozialdemokraten in nahezu allen imperialistischen Ländern in erster Linie und entgegen ihrer eigenen Ideologie als Totengräber des jeweiligen Sozialstaats betätigt. Sie sind offenbar fest entschlossen dieses Geschäft im Namen der Rettung des Sozialstaats fortzusetzen. Entweder aus zynischer Überzeugung oder aus Dummheit. Es steht zu befürchten, daß Bischoff & Co. an ihre eigenen Legenden glauben. Deshalb fehlt ihnen in der Auseinandersetzung mit Herrschaften wie Harald Wolff, Stefan Liebich jede Konsequenz.
- Schließlich wird von Ihnen auf die notwendige Umwälzung der Rohstoffbasis und den Übergang zu nicht-fossilen Energieträgern als ein Moment der Zivilisierung des Kapitalismus verwiesen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus:
Die wachsende Nachfrage nach Energie bei gleichzeitiger Verknappung der Erdölvorräte; die Verlangsamung der Entdeckung neuer Lagerstätten, die trotz steigender Preise profitabel erschlossen werden können, setzt nicht nur die "Veränderung der Rohstoffbasis" und den "Übergang zu nicht-fossilen Energieträgern" auf die Tagesordnung, sondern führt zur extremen Zuspitzung des Kampfs um die Kontrolle der Lagerstätten der noch vorhandenen fossilen Energieträger, ihrer Transportwege und des Weltenergiemarktes. Wir stehen vor Jahren und möglicherweise Jahrzehnten gewaltsamer Konflikte. Der Golfkrieg und die wachsenden Spannungen zwischen dem Imperialismus und dem Iran sind Teil dieses Szenarios, ebenso der Kampf um Einfluß in den mittelasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken, aber auch die zunehmende Aggressivität gegenüber emanzipatorischen Bewegungen in Lateinamerika und die immer häufigeren militärischen Interventionen in Afrika.
Die Aufgabe einer ernstzunehmenden Linken besteht nicht darin, eine technologische Modernisierung im Namen einer wertfreien ökologischen Erneuerung zu fördern - was im Zuge steigender Energiepreise profitabel wird, wird ohnehin gemacht werden, sondern über die katastrophalen Auswirkungen der Fortsetzung der verschwenderischen kapitalistischen Marktökonomie aufzuklären. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und deren verantwortliche und für künftige Generationen nachhaltige Bewirtschaftung ist nur möglich, wenn der Kapitalismus aufgehoben wird.
Der Gruppe um die Redaktion der Zeitung "Sozialismus" (nach Lage der Dinge ein irreführender Name: "Sozialkapitalismus" wäre treffender) verweist darauf, daß es in der Linkspartei/PDS und der WASG um die gesellschaftlichen Zielperspektiven keine seriöse Debatte gegeben hat, obwohl offenkundig ist, daß es ohne programmatischen Konsens in Grundfragen in aller Regel auch keine gemeinsame Tagespolitik gibt.
Wer sich nicht "über die Gründe des Scheiterns der Sozialismus-Versuche verständigt" hat oder darüber, daß gesellschaftliche Arbeit eine Schlüsselkategorie zum Verständnis der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Transformation ist, wird sich kaum darüber einigen, ob es sinnvoll ist, für die Rücküberführung von privatisierten Bereichen in öffentliche Regie zu streiten. Auch die Forderung nach einer deutlichen Ausweitung öffentlicher Investitionen und öffentlicher Beschäftigungsprogramme wird von vielen Realpolitikern für eine Überforderung "linker" Realpolitik gehalten.
Die Haltung zur Eigentumsfrage:
Es gehört zu den rhetorischen Standardtaschenspielertricks der zu Sozialdemokraten gewendeten Exstalinisten in der Linkspartei/PDS, die Eigentumsfrage für überwunden zu erklären. Es gehe vielmehr um die Frage der Verfügungsgewalt, erklären sie. Sie verschweigen, daß Eigentum gerade dadurch definiert ist, unter prinzipiellem Ausschluß von Nichteigentümern nach Belieben über eine (eigene) Sache verfügen zu können. Die juristische Eigentümerstellung ist deshalb entscheidende Voraussetzung dafür über Produktionsmittel verfügen zu können. Der juristische Eigentümer kann Verfügungsgewalt in den verschiedensten Formen delegieren. Er muß die Verfügungsgewalt nicht selbst ausüben. Juristisches Volkseigentum als allgemeinste juristische Form des Kollektiveigentums z.B. kann nicht unmittelbar vom Volk ausgeübt werden, sondern muß grundsätzlich delegiert werden. Die Verfügungsgewalt kann dabei bei durch beauftragte Manager, durch Genossenschaften, durch Belegschaftsräte, etc. ausgeübt werden, die Verfügungsgewalt kann dabei hierarchisch gestaffelt bzw. geteilt werden (z.B. Rahmenentscheidungen in übergeordneten Plangremien, Ausführungsentscheidungen auf Betriebebene) u.sw. u.s.f.
Nur eines ist prinzipiell nicht möglich: Die Frage nach der Verfügungsgewalt von der Eigentumsfrage zu trennen. Das müßte gerade den alten Appratschiks der DDR klar sein: Die von der Arbeiterklasse unkontrollierte Verfügungsgewalt der Bürokratie über den Produktionsapparat der DDR und die Übernahme der Kontrolle über das Volkseigentum durch die Treuhand führte zum Entzug der Verfügungsgewalt durch die neuen bürgerlichen Verwalter des Volks-Eigentums. Die Bürokraten hatten zwar bis zur Wende die Verfügungsgewalt über das Volkseigentum, aber kein Eigentum. Deshalb konnten sich die alten Bürokraten nicht ohne weiteres zu Privateigentümern mausern. Wer ersthaft über Verfügungsgewalt sprechen will, kann also die Eigentumsfrage nicht ignorieren. Wer die Eigentumsfrage nicht anrührt, will das Kapital im Kern unangetastet lassen. So einfach ist das.
Joachim Bischoff und seine Mitstreiter vollführen hier einen Eiertanz. (Alte) Verstaatlichungsforderungen sind ihnen unangenehm, neue wollen sie nicht, weil ja nicht geklärt sei, was heute Schlüsselindustrien sind. An Banken und Versicherungen, die Autoindustrie oder den Energiesektor trauen sie sich offenbar nicht einmal auf dem Papier heran, sondern bringen stattdessen Genossenschaften und einen neu zu schaffenden "non-profit"-Sektor ins Spiel. Das wird das Kapital ganz sicher schwer beeindrucken...
Die Kritik der Parteirechten der Linksspartei/PDS am Gründungsaufruf für die neue Partei ist da offener und ehrlicher. Sie illustriert zugleich die Probleme der neuen Partei zwischen Realpolitik und den Bedürfnissen ihrer Wähler. Trotz der vielen Halbheiten des Gründungsaufrufs und trotz seines Bekenntnisses zu einem Reformkapitalismus gehen den realpolitischen Apparatschiks und den in Landesregierungen strebenden Landesfürsten der Linkspartei/PDS dessen verbale Konzessionen an die Linke viel zu weit.
Für Marxisten sind demgegenüber Verstaatlichungsforderungen sowohl eine Möglichkeit ihre grundsätzliche Opposition gegen die herrschenden Verhältnisse als auch ihren Gegensatz zu den reformistischen Schönrednern des Kapitalismus zum Ausdruck zu bringen. Die rhetorischen Konzessionen Lafontaines an die Linke (und die sich verbreitende Einsicht, daß es ohne einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Umbruch nicht geht), ist für die Parteirechte der L/PDS deshalb nicht tolerabel.
So verkündet der Fraktionschef der L/PDS in Sachsen/Anhalt, Wulf Gallert, daß die PDS den skandinavischen Raubtierkapitalismus "ganz toll" findet und spricht sich unter Berufung auf die historischen Erfahrungen der DDR grundsätzlich gegen Verstaatlichungsforderungen aus[3]. Dahinter blitzt immerhin die Erkenntnis auf, daß jeder Kapitalismus Raubtierkapitalismus ist, sobald er stark genug ist, auf Raubzüge zu gehen. Seine Begründung für die Ablehnung von Verstaatlichungen: Man könne nicht schlüssig erklären, daß es möglich ist, "mit Staatseigentum grundsätzlich effizienter wirtschaften", und er verweist süffisant darauf, daß der Aufruf an anderer Stelle selbst die Notwendigkeit des Wettbewerbs anerkennt. Gallert setzt sogar noch gleich zwei Schläge d'rauf: Er bekennt sich zu Stellenkürzungen und sozialen Kürzungen "in Ostdeutschland, wo die Bevölkerung sinkt" und er betont, daß Linkspartei/PDS-Programme nicht die Grundlagen für die Arbeit von Regierungskoalitionen sein können: "Man darf nicht verlangen, dass ein Koalitionspartner unsere Grundsätze übernimmt." Besser kann die Haltung der die Linkspartei maßgeblich bestimmenden Parteiströmung nicht auf den Punkt gebracht werden. Wir machen, was wir für richtig halten. Und: Kommt uns nicht mit demagogischen Papieren in die Quere, die über Wahlen hinaus dazu führen könnten, daß Wähler uns mit überzogenen Ansprüchen konfrontieren.
Im Aufruf "Abschied und Wiederkehr - Aufruf aus der neuen Linkspartei in Deutschland"[4], unterzeichnet von Parteirechten der L/PDS wie Dietmar Bartsch, Mathias Höhn, Kerstin Kaiser, Peter Porsch, Thomas Falkner und Roland Claus, wurde inzwischen als Gegenentwurf zum Gysi-Lafontaine-Gründungsaufruf ein entschiedenes Bekenntnis zum vorgeblich ideologiefreien Pragmatismus ohne irgendwelche Zielvorgaben abgelegt. Jedem "Avantgarde-Anspruch" wird mit dem dummdreist demagogischen Argument eine Absage erteilt, es gebe "keine ein für allemal fertigen und endgültigen Antworten." Dem auf diese Weise karikierten und vermeintlich fertiggemachten linken Feind wird stattdessen "das uralte zivilisationsgeschichtliche Gebot von Mitmenschlichkeit" entgegengehalten. So positioniert dürfte die kommende neue Linkspartei Mühe haben, ihre gesonderte Existenz von den Sozialausschüssen der Unionsparteien zu begründen. Der graue Alltag kapitalistischer Krisenverwaltung läßt grüßen.
Fazit:
Die Gruppe um Bischoff wünscht sich den Gründungsprozeß der neuen Linkspartei als Verständigungs- und Sammlungsprozeß. Im Vordergrund sollte jedoch ein Klärungsprozeß stehen. Dazu müßte die Frage beantwortet werden, was sich da eigentlich sammelt. Sodann müßte eine offensiv geführte Auseinandertzung mit dem rechten Parteiflügel stattfinden. Hierzu hat diese Gruppe aber wenig beizutragen. Sie fordert zwar eine Debatte um qualitativ neue Modelle der Wirtschaftssteuerung "jenseits überholter Planmodelle", einen neuen "Ansatz gesellschaftlicher Demokratisierung", um "Gegenmacht in Wirtschaft und Gesellschaft" zu stärken, bleibt aber jeden Ansatz einer konkreten Antwort schuldig. Fragt sich nur, weshalb sie die Debatte nicht einfach dadurch eröffnen, daß sie ihre Konzepte auf den Tisch legen. So formulieren sie nur ihr intellektuelles Unbehagen am Feuerwerk der Lafontaineschen politischen Rhetorik.
Schon die ersten Diskussionsbeiträge aus dem reformistischen Lager zum Gründungsaufruf belegen, daß es selbst unter den Reformisten kaum logisch überbrückbare Differenzen gibt. Die Lösung wird pragmatisch gefunden werden: Die meisten Reformisten werden sich in der Praxis auf dem rechtesten Nenner einigen und ihre Positionspapiere beizeiten vergessen. Bei Bedarf, in Wahlkämpfen, können sie dann immer noch schwätzen, als gebe es die rechte Praxis nicht.
Sowohl die Praxis als auch die Debatte zeigt, daß die praktisch maßgebenden Reformisten von ihrer Linie keinen Millimeter abgehen und Dissidenz nur so lange dulden, wie sie die reformistischen Kreise nicht behelligt. Es ist bezeichnend, daß selbst ein so zugkräftige Politstar wie Oskar Lafontaine mit seiner linken Rhetorik bei der Parteirechten der Linkspartei/PDS schon ein unüberhörbares Grummeln hervorruft. Wer so unverständig ist, als Linker auf tatsächlich emanzipatorischer Politik zu beharren, wird schnell aufgeklärt, werden, daß Sammlungsbewegungen nicht notwendig mit innerparteilicher Demokratie, Diskussion und Pluralität verbunden sein müssen. Es geht auch ganz altbacken, bürokratisch-zentralistisch. Berlin war und ist in dieser Hinsicht ein Lehrstück.
Die Frage ist, ob marxistische Strömungen in einer solchen Partei existieren können? Wer sich mit einer Randexistenz als linkes Feigenblatt ohne politischen Widerstand gegen die Rechtsreformisten nach dem Muster der Kommunistischen Plattform der PDS bescheidet, ganz sicher. Wer aber Widerstand leistet, den opportunistischen Konsens nach außen durchbricht und/oder gar die Koalitionsbereitschaft des Wunschpartners SPD gefährdet, wird Schwierigkeiten bekommen - nicht nur mit dem bisherigen Apparat der L/PDS, sondern ebenso mit den Parteigängern Klaus Ernsts. Das wird die WASG-Linke bedenken müssen, wenn sie mit der L/PDS fusioniert.
Dieter Elken (Marxistische Initiative), 07.07.06
| [1] | Joachim Bischoff, Richard Detje, Hasko Hüning, Björn Radke: Neue Linke - neue Partei? Zum Aufruf zur Gründung einer neuen Linken, in: www.sozialismus.de (Sozialismus 7-8/2006,27ff) |
| [2] | ND vom 07.07.06 |
| [3] | ND-Interview, Ausgabe vom 27.06.06: "Gefahr des Scheiterns ist real" |
| [4] | http://sozialisten.de/sozialisten/nachrichten/view_html?zid=33215&bs=1&n=0 |