| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: PDS / Linkspartei | 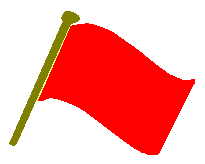 |
Reformistische Halbheiten anstelle von marxistischem Klartext:
Lafontaine zu den Grundlinien linker Politik
Lafontaine forderte auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz die Linke auf, sich nicht vom politischen Gegner dessen Sprache aufzwingen zu lassen. Globalisierung sei nichts anderes als zeitgenössischer Kapitalismus, die Senkung der Lohnnebenkosten bedeute Abbau des Sozialstaats für Arbeitslose, Rentner und Pflegebedürftige. Flexibilisierung heiße weniger Kündigungsschutz und Arbeitszeiten nur nach den Bedürfnissen des Kapitals. Das alles ist richtig.
Lafontaine folgert daraus: "Der Auftrag der Linken (ist) aus den Gegenbegriffen abzuleiten." Das ist so falsch wie es (zu) einfach klingt. Wer auf der Ebene der Begrifflichkeiten bleibt, riskiert, dem Oberflächenschein der kapitalistischen Gesellschaft verhaftet zu bleiben. Schein und Sein sind im Kapitalismus jedoch nicht dasselbe. Sozialistische Politik ist deshalb aus der Analyse des modernen internationalen Kapitalismus, seiner Widersprüche und nicht zuletzt den Interessen der Klasse der Lohnabhängigen abzuleiten, d.h. der Arbeiterklasse. Lafontaine erkennt zwar, daß die neoliberale Ideologie die moderne kapitalistische Ideologie ist, doch setzt er dieser Ideologie nicht eine antikapitalistische, sondern nur eine andere Perspektive entgegen. Diese erweist sich ebenfalls als kapitalistisch.
Lafontaine erklärt, linke Politik habe gegen den Neoliberalismus Widerstand zu leisten. Mit diesem Widerstand muß wirksame linke Politik tatsächlich anfangen. Er weist in diesem Zusammenhang richtig daraufhin, daß die neoliberale Ideologie "auch die Gewerkschaftsbewegung infiziert" hat. Die hat dadurch an der sog. Deregulierung und mit ihren sog. Bündnissen für Arbeit am Reallohnabbau kräftig mitgewirkt. Lafontaine schweigt sich jedoch dazu aus, wie er angesichts dieser Sachlage die Gewerkschaften wieder zu Zentren des Widerstands machen will. Er verliert erst recht kein Wort darüber, wie trotz der neoliberalen Infizierung der Gewerkschaften der Widerstand entwickelt werden kann, ob nun innerhalb oder außerhalb der Gewerkschaften. Er übergeht außerdem das Problem, wie aus bloßem Widerstand ein planvoller Kampf für sozialistische Ziele werden kann.
Widerstand gegen den Neoliberalismus allein ist noch keine Perspektive
Die Linke kann nicht bloß beim Widerstand stehen bleiben. Sie braucht die sozialistische Zielperspektive. Lafontaine übersieht geflissentlich, daß neoliberale Politik nicht Ausfluß bösartiger Charakterzüge wildgewordener kapitalistischer Manager ist, sondern weltweit die den Interessen der Bourgeoisie entsprechende Politik im modernen Kapitalismus ist. Ebenso ist die gegenwärtige Militarisierung der deutschen Außenpolitik nicht einer plötzlichen besonderen Kriegslüsternheit der Schröder, Fischer, Merkel oder Schäuble geschuldet, sondern sie ist die der neuen Weltlage adäquate bürgerliche Interessenpolitik. Eine Politik des Widerstands gegen die zeitgenössische oder neoliberale Sozial- und Wirtschaftspolitik, die nicht zugleich antikapitalistisch ist, ist deshalb illusionär und zum Scheitern verurteilt. Sie ist ebenso illusionär wie der Versuch, der Bourgeoisie und ihrer "politischen Klasse" die Rückbesinnung auf das Völkerrecht und humanitäre Werte im Umgang mit der Dritten Welt zu predigen und dies bereits als linke Politik verkaufen zu wollen, anstatt eine sozialistisch-internationalistische Solidaritätspolitik zu praktizieren, was bereits hier und heute möglich ist.
Die Regierungsfrage
Lafontaine hat in seiner Rede nicht offen ausgesprochen, daß seine gesellschaftliche Vision die des wiederbelebten bürgerlichen Sozialstaats wie zu Ende der sechziger bzw. Anfang der siebziger Jahre ist. Er hängt wie alle Reformisten der wenig wirklichkeitsnahen Vorstellung an, man könne die (Regierungs-)Kontrolle über den Staat dazu nutzen, nach Belieben und ohne Rücksicht auf die reale Bourgeoisie den Kapitalismus zu regulieren. Die historischen Erfahrungen zeigen jedoch, daß jeder Verstoß gegen wichtige Bedürfnisse der Kapitalverwertung zu Kapitalflucht, Investitionsstreik und zu verschärftem Klassenkampf führen. Dies hat noch jeden konsequenten Reformisten zur (kapitalistischen) Räson gebracht - freiwillig oder mit Zurhilfenahme mehr oder weniger offener Gewalt.
Kompromisse
Aber die wenigsten Reformisten sind konsequent. Vor jeder Konsequenz kommt der Kompromiß, die Verbeugung vor dem aktuellen gesellschaftlichen Kräfteverhältnis. Jeder Gewerkschafter weiß, daß nicht jede Forderung jederzeit voll durchsetzbar ist. Das ist jedoch für jeden guten Gewerkschafter kein Grund, Teile des Unternehmerprogramms zu übernehmen. Kompromißbereitschaft muß Grenzen haben.
Lafontaine ist ein kluger Reformist - im Gegensatz zu den meisten Führungskräften der L/PDS. Er weiß jedoch trotzdem nicht, wo Kompromisse nötig und wo sie schädlich sind. Auch Lafontaine befürwortet die Übernahme von Verantwortung für kapitalistische Regierungsgeschäfte und die Bildung von Koalitionen. Er nennt das das Eingehen von Kompromissen. Im Gegensatz zu den Liebichs, Wolfs, Holters und und Kaisers von der L/PDS ist ihm wenigstens bewußt, daß es dabei Grenzen geben muß, wenn die Linke glaubwürdig bleiben will: " Wer ernsthaft sagt, wir wollen die Gesellschaft sozial gestalten, der darf nicht Kernbereiche gesellschaftlicher Verantwortung in den Gemeinden und in den Ländern immer weiter privatisieren."
Dem entspricht die neuere Beschlußlage selbst der L/PDS. Die Frage, wo und zwischen wem Kompromisse notwendig sind und wo Grenzen für Kompromisse gesetzt werden müssen, ist damit jedoch falsch beantwortet..
Lafontaine hat natürlich völlig recht, wenn er feststellt, daß eine Linke, die blauäugig zuguckt, wie immer mehr kommunale Dienstleistungen privatisiert werden, zur Regulierung oder gar der Verstaatlichung des Bankensektors schweigen sollte. Und er hat recht, wenn er im Hinblick auf die aktive Mitwirkung der L/PDS an Privatisierungen in Berlin und Dresden um die Glaubwürdigkeit der Linken fürchtet. Aber es geht nicht nur um Privatisierungen. Wenn sich die Berliner PDS zum Vorreiter einer reaktionären Tarifpolitik im Öffentlichen Dienst macht, Krankenhäuser schließt und die Kita-Gebühren erhöht, ist das nicht minder schädlich für die Glaubwürdigkeit der Linkspartei/PDS als wenn Wohnungen oder Wasserwerke privatisiert werden. Jede Übernahme von politischer Verantwortung für reaktionäre Politik beschädigt die Glaubwürdigkeit einer Partei, die sich als linke Partei präsentiert.
Auf der Bundesebene ist noch offenkundiger, daß die Ablehnung von Privatisierungen kein ausreichendes Kriterium ist, die Glaubwürdigkeit der Linken zu bewahren: Sollte die Linke etwa für den Verzicht auf weitere Privatisierungen im Bund die Beteiligung der BRD an weiteren Kriegen hinnehmen und ihre Kriegsteilnahmen damit bemänteln, daß sie auf Leute wie Bush einen "mäßigenden Einfluß" nimmt, etwa so wie Blair? Sollte sie die Durchsetzung von weiteren Rentenkürzungen in einer Regierungskoalition mit dem Verzicht auf weitere Privatisierungen rechtfertigen? Soll sie hinnehmen, daß mit Kriegsverbrechern und Staatsterroristen weiter Freundschaft gehalten wird? Die Fragen stellen, heißt, sie zu verneinen.
Wir wollen alles!
Linke können keine "Verantwortung" für das bürgerliche "Ganze" übernehmen. Sie übernehmen Verantworzung nur für ihr eigenes Programm. Sie predigen ihrer sozialen Basis nicht Verzicht, sondern Widerstand. Sie setzen sich nicht dafür ein, sich mit dem kapitalistischen Mangel zu bescheiden, sondern sich weitergehende Ziele zu setzen und den grundsätzlichen Wandel der Gesellschaft durchzusetzen. Anders kann das gesellschaftliche Kräfteverhältnis nicht nachhaltig verändert werden. Linke können sich deshalb weder an bürgerlichen Regierungen beteiligen noch sie tolerieren. Eine Beteiligung an Regierungen kommt nur da in Betracht, wo ernsthaft der sozialistische Umbau der Gesellschaft angepackt wird. Und vorher?
Kein Frieden für die Große Koalition
Das Problem Lafontaines und anderer deutscher Reformisten ist, daß sie sich effektive Parlamentspolitik nur als Regierungspolitik vorstellen können. Sie akzeptieren das (dem realen Bedürfnis nach stabilen Rahmenbedingungen für die Kapitalverwertung zum Ausdruck bringende) bürgerliche Dogma, daß sich eine Regierung auf eine stabile, eigene Parlamentsmehrheit stützen können muß.
Eine stabile bürgerliche Regierung ist jedoch das allerletzte, was konsequente Sozialisten wollen. Linke wollen die bürgerliche Politik schwächen und eine starke, durchsetzungsfähige und möglichst breite sozialistische Bewegung aufbauen. Sie sind deshalb auch gegen jedes Bündnis der Sozialdemokratie mit der CDU/CSU oder der FDP. Sie sind dafür, die SPD zu bedrängen, einen Kurswechsel zu vollziehen, wohlwissend, daß dies zur Zerreißprobe für die Sozialdemokratie führt, deren Führung sich ans Bündnis mit der herrschenden Klasse klammert. Die SPD bindet sich gern an andere, rechtere Parteien - nicht, weil sie eine linkere Politik will, sondern, weil sie angesichts der Bedürfnislage ihrer Basis diese Bündnisse als Vorwand für ihre Politik braucht.
Die SPD auffordern, die Große Koalition zu verlassen
und wenigstens eine Minderheitsregierung zu bilden
Wenn die SPD nur einen kleinen Schritt weit von ihren bürgerlichen Partnern lösen will, fordern Linke sie auf, wenigstens eine Minderheitsregierung zu bilden, gestützt auf wechselnde parlamentarische Mehrheiten.
Damit haben unsere staatstreuen Reformisten Probleme. Sie können sich nicht vorstellen, daß es, wie in vielen skandinavischen Ländern und anderswo oft praktiziert, Minderheitsregierungen geben kann, die sich auf wechselnde parlamentarische Mehrheiten stützen - je nach Sachfrage. Sie erkennen auch nicht, daß eine solche (scheinlinke, z.B. sozialdemokratische) Minderheitsregierung - ohne die Beteiligung der sozialistischen Linken - der Linken einen viel größeren taktischen Handlungsspielraum eröffnet, als an faule Kompromisse gekettete halblinke Koalitionen oder etwa Tolerierungsbündnisse. Die Verträge, die derartigen Bündnissen mit weiter rechts stehenden Parteien wie der Sozialemokratie zugrundeliegen, sind nämlich nichts weiter als Vereinbarungen über den Verzicht auf Widerstand gegen die aktuelle bürgerliche Politik.
Weil die Reformisten das Dogma der Notwendigkeit stabiler Regierungsmehrheiten kritiklos akzeptieren, verzichten sie wie die Fraktion der Linkspartei im Bundestag darauf, die SPD wegen ihrer reaktionären, ihr vorgeblich von der CDU aufgezwungenen Kompromisse unter Druck zu setzen. Die Tatsache der Großen Koalition wird stillschweigend, manchmal sogar mir Erleichterung hingenommen, das Jahr 2009 und den nächsten regulären Wahltermin fest im Blick. Deshalb der von der Bundestagsfraktion vermittelte der L/PDS vermittelte Eindruck der konzeptlosen Schlafmützigkeit.
Das Bekenntnis der sozialdemokratischen Führung zu ihrer "staatspolitischen Verantwortung" (sprich: ihrer Bindung an Kapitalinteressen) wird nicht hinterfragt. Es wird auch nicht angeprangert, daß sie ihren Schmusekurs mit Kriegsverbrechern, Verantwortlichen für Folter oder die Politik des Sozialabbaus nicht sofort beendet. Der Respekt vor dem Fetisch der "stabilen Regierung" geht soweit, daß die Reformisten sogar darauf verzichten, die SPD aufzufordern, wenigstens die positiven Kleinstreförmchen sofort durchzusetzen, zu denen sie sich verbal bekennt - gestützt auf eine dafür jeweils mögliche punktuelle linke Mehrheit im Parlament. So kann man sich darauf berufen, daß bis 2009 scheinbar ohnehin nur verbaler Protest in Form von wohlfeilen Presseerklärungen gegen die aktuelle Politik möglich ist und es sich in den Parlamentsbüros gemütlich machen, anstatt die SPD mit immer neuen Kampagnen aufzumischen.
Dieter Elken, 03.02.06