| Startseite | Impressum | Suchen | Rubrik: Basisdokumente | 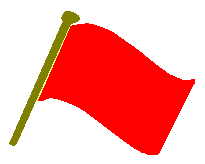 |
Bürgerliche Reformpolitik oder Sozialismus?
Der reformistische Mythos
Es wird häufig vergessen, daß die wichtigsten Errungenschaften der westdeutschen Arbeiterbewegung nach dem 2. Weltkrieg nicht der parlamentarischen Arbeit der SPD, nicht dem Geschick von Reformisten oder einem sozialdemokratischen Modell, sondern Zugeständnissen der herrschenden Klasse unter CDU-Regierungen zu verdanken sind. Das war in den meisten Ländern Westeuropas und Nordamerikas nicht viel anders.
Diese Zugeständnisse waren möglich, weil das sogenannte Wirtschaftswunder der fünfziger und sechziger Jahre den Kapitalisten Spielraum für Zugeständnisse ermöglichte. Die damals vorhandenen Verteilungsspielräume waren aber nicht das Ergebnis irgendeiner Art von inzwischen verloren gegangener Genialität in Sachen Reformpolitik, sondern ergaben sich aus der besonderen Nachkriegs- und Wiederaufbausituation. Hinzu kam, daß die Systemkonkurrenz im Kalten Krieg diese Zugeständnisse unumgänglich machte. Besonders nach dem Mauerbau 1961 genügten dann aufgrund des Arbeitskräftemangels häufig schon Streikdrohungen, um kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne durchzusetzen.
Der erste Frühling des Reformismus:
Vom demokratischen Aufbruch zu Berufsverboten und Sparpolitik
Die Stunde der Sozialdemokratie schien erstgekommen, als sich der kapitalistische Wirtschaftsboom seinem Ende zuneigte. Die SPD wurde gebraucht um die ersten Risse im scheinbar unerschütterlich gewordenen Fundament der kapitalistischen Gesellschaft zu kitten. Die SPD wurde gebraucht, um den 1968 verloren gegangenen gesellschaftlichen Konsens wiederherzustellen.
Als 1969 unter Willy Brandt die erste sozialliberale Koalition die Regierung übernahm, versprach sie deshalb mehr Demokratie und kündigte weitere Reformen an. Ihr erstes großes Reformwerk war die Rentenreform, die die Lage der damaligen Rentner tatsächlich sofort spürbar verbesserte. Aber das schnelle Erlahmen des Wirtschaftswunders in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ließ die Blütenträume des sozialdemokratischen Reformismus unter Brandt welken. Dessen Reformen waren der deutschen Bourgeoisie zu teuer und seine Versprechen, mehr Demokratie zu wagen, erschienen ihr angesichts einer neuen, unberechenbaren und sich radikalisierenden Linken zu riskant. Sie drängte auf einen Politikwechsel und setzte auf neue Massenarbeitslosigkeit als Druckmittel gegen die Arbeiterklasse.
Die SPD parierte. Statt mehr Demokratie setzte es ab 1972 wieder Berufsverbote. Als Brandt auch ansonsten nicht schnell genug reagierte mußte er 1973 gehen. Statt auf Entspannung setzte die SPD dann unter Helmut Schmidt auf Aufrüstung. Da staatliche Investitionsprogramme nach den Rezepten von Keynes keine neuen Wunder bewirkt hatten, ging die SPD unter Helmut Schmidt zu Sparpolitik und Sozialabbau über. Es begann eine erste Ära des Neoliberalismus.
Aber auch die Illusion, dadurch wieder Spielräume für einen neuen Reformschub zu schaffen, zerplatzte, weil die sozialdemokratischen Realpolitiker damals wie heute die Tatsache unterschätzt hatten, daß das den Kapitalismus regierende Prinzip das der Profitmaximierung ist. Die Bourgeoisie kennt weder Bescheidenheit noch Selbstbeschränkung. Die Entschlossenheit Schmidts, das neoliberale Programm des Kapitals umzusetzen, vergrätzte SPD-Wähler, führte zum Aufstieg der Grünen und kostete die SPD erstmals die Regierungssessel. Und die Bourgeoisie war auch nicht zufriedengestellt. Sie wollte mehr.
Die Ära Kohl - eine Ära neoliberaler Mittelmäßigkeit
Von 1982 bis 1989 setzte Helmut Kohl die von Helmut Schmidt begonnene Politik fort, ohne eigene Akzente - und ohne jeden Widerstand der SPD. Die dem Ideal der Sozialpartnerschaft der Blütephase des Nachkriegskapitalismus anhängenden Gewerkschaftsführungen waren nicht fähig, der neoliberalen Wende mehr als bestenfalls hinhaltenden Widerstand entgegenzusetzen. Eigene Perspektiven für eine autonome Interessenpolitik der Lohnabhängigen waren und sind Fehlanzeige. Sie blieben befangen in der Logik der von ihnen akzeptierten kapitalistischen Zweckrationalität. Sie blieben deshalb passiv und waren zu effektiver Interessenvertretung der Lohnabhängigen nicht in der Lage.
Die Wende verhalf dem Neoliberalismus zu längerem Leben
Die sich dann ab 1989 abzeichnende Krise überstand Kohl unbeschadet durch das unerwartete Geschenk des Zusammenbruchs der Arbeiterstaaten Mittel- und Osteuropas und der deutschen Vereinigung. Der Zusammenbruch der DDR und die daraus folgende Phase der Desorientierung und Demoralisierung der Arbeiterbewegung ermöglichte in den neuen Ländern einen beispiellosen Schlag gegen deren Errungenschaften, gegen Vollbeschäftigung, öffentliche Dienstleistungen, das Gesundheitssystem, kulturelle Einrichtungen und das Bildungssystem - nur schlecht abgemildert durch Lohnersatzleistungen. Der Sieg im Osten machte der herrschenden Klasse Appetit im Westen. Als Kohl dann den neoliberalen Kurs Mitte der neunziger Jahre erneut bzw. gesamtdeutsch forcierte, schlug 1998 die Stunde Schröders, der mit Lafontaine die Rückkehr zu echter sozialdemokratischer Reformpolitik versprach.
Schröders Anfänge:
Vom reformistischen Flop zum neoliberalen Sturmlauf
Nachdem die rotgrüne Koalition nach der Wahl begonnen hatte, einige kleinere der Konterreformen Kohls rückgängig zu machen, genügten der Bourgeoisie wenige Wochen Protest, um sich bei Schröder Gehör zu verschaffen und die Regierung erfolgreich zur Ordnung zu rufen. Schröder übte seine Richtlinienkompetenz aus und Lafontaine kapitulierte kampflos. Es folgte ein rotgrüner Sturmlauf gegen die Grundfesten des deutschen Sozialstaats. Die Wahl 2002 überstand Schröder, weil es ihm trotz der Kriegseinsätze der Bundeswehr gelang, sich durch die Opposition gegen Bushs Irakkrieg als Friedenskanzler darzustellen.
Dieser Erfolg ließ die SPD über die Tatsache hinwegsehen, daß ihre soziale Basis wegbröckelte. Da die Gewerkschaftsführungen seit Jahren jeden effektiven Widerstand der Gewerkschaftsbewegung gegen die neoliberale Politik blockieren, drückte sich die Unzufriedenheit immer größerer Teile der Arbeiterklasse in geringeren Wahlbeteiligungen und in der Entstehung eines vagabundierenden Protestwählerpotentials aus, das sich mangels linker politischer Alternative z.T. auch neofaschistischen Parteien zuwandte. Die PDS unternahm keinen Versuch, zum Kristallisationskern einer neuen Widerstandsbewegung zu werden. In einer Phase, in der sich immer größere Teile der Basis von der SPD abwandten, paßte sie sich an deren Politik an. Die Folge war ihre Stagnation mit abnehmender Tendenz. Mit einer derartigen Politik würde der Rechten auch in Zukunft wieder der Weg bereitet werden.
Die Krise der bürgerlichen Politik ...
Schröders taktisches Manöver, nach der jüngsten der Kette schwerer Wahlniederlagen in den Ländern die Flucht nach vorn anzutreten und Neuwahlen anzukündigen, hat die politische Landschaft der BRD von rechts bis links in Aufregung versetzt.
Die CDU/CSU sieht sich schon wieder an den Schalthebeln der Macht. Angelas Merkels erste Rechung, bis zur Wahl über politische Inhalte nicht zu reden, damit niemand merkt, daß sie prinzipiell kein anderes Programm als Schröder hat, ging nicht auf. In den Reihen der Christdemokraten begann nicht nur der Kampf um die zu besetzenden Posten, sondern auch der Streit um den künftigen politischen Kurs.
Die ganze Palette neoliberaler Wunschzettel liegt auf dem Tisch: Erhöhungen der unsozialen Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer) und Steuersenkungen für das Kapital, die Verschleuderung (Privatisierung) öffentlichen Eigentums und die Zerschlagung der sozialen Infrastruktur, die Entmachtung der Gewerkschaften, Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich, die Spaltung der Arbeiterklasse durch Nationalismus und Rassismus. Teile der Union wollen das Tempo des neoliberalen Sturmlaufs verschärfen, andere fürchten, die SPD könne sich womöglich erfolgreich wieder als kleineres Übel präsentieren.
Im Hintergrund steht die Furcht vor einer neuen Radikalisierung durch zu erwartende Mobilisierungen der Arbeiterklasse und die durch die Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden genährte Ahnung, daß es in Deutschland keine wirklichen Mehrheiten für neoliberale Politik gibt. Neoliberale Politik, die aus Sicht der herrschenden Klasse zeitgemäße bürgerliche Politik, ist derzeit nur mit Wählerbetrug durchsetzbar.
Hin- und hergerissen zwischen dem Zwang, der eigenen bürgerlichen Klientel alles zu versprechen, und der Notwendigkeit, der SPD keine Steilvorlagen zu liefern, entstand ein Wahlprogramm, das mit den angekündigten Maßnahmen (Steuererhöhung für die Arbeiterklasse, drastische Einschränkung der Arbeitnehmerrechte) die Verschärfung des Schröder-Kurses verspricht und den Christdemokraten doch die Hoffnung läßt, die Verärgerung über die Politik Schröders möge zum Wahlsieg reichen.
... und die Krise der Linken
Die demoralisierte SPD sieht sich einerseits genötigt, Schröder ins Tränental einer staatstragenden, verantwortungsbewußten parlamentarischen Opposition zu folgen und hofft andererseits zugleich, daß ihre verbliebene Stammwählerschaft die Schmierenkomödie ernst nimmt, daß Müntefering zu sich selbst und seinem Kanzler in Opposition tritt und zugleich dessen Kurs weiter bedingungslos unterstützt. Die SPD-Linke mag immer noch nicht einsehen, daß es sich auf Dauer keine Partei erlauben kann, eine gegen die sozialen Interessen ihrer Wählerbasis gerichtete Politik zu betreiben. Sie hofft wacker auf den Erhalt ihres Nischendaseins, sprich: ihre Pöstchen, und trägt deshalb grundsätzlich jeden Unsinn ihrer Parteiführung mit. Sie fordert allenfalls, am Unfug kosmetische Korrekturen vorzunehmen.
Die PDS hat es mit Ausnahme der letzten Wahl zum Europäischen Parlament trotz ihres immer noch linken Images aufgrund ihrer tatsächlich rechtssozialdemokratischen Regierungspraxis nirgendwo geschafft, vom verbreiteten Unmut und der Wut über die neoliberale Politik der rotgrünen Koalition zu profitieren. Bis jetzt können und wollen ihre Vordenker nicht begreifen, daß die mit der rotgrünen Koalition zutiefst unzufriedenen Wählerinnen und Wähler, die sich massenhaft von Schröder & Co. abwenden, eine zu diesen Herrschaften konfrontative Alternative suchen und keine Partei, die sich der SPD bis zur Unkenntlichkeit anpaßt. Die PDS, die im Osten, besonders in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, Mühe hat, ihre traditionelle Klientel zu halten und aufgrund der dort betriebenen Politik überall wenig glaubwürdig ist, konnte nie sicher sein, daß sie den Wiedereinzug in den nächsten Bundestag schaffen würde. Die Unsicherheit wich der Angst vor dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit, nachdem die WASG gegründet wurde.
Auch die WASG ist das Produkt einer (doppelten) Krise:
Da ist einmal die Krise der extremen Linken, die nach Jahren der Isolation dem Ghetto der linken Szene entkommen wollte und in der eine ganze Reihe von Gruppen als Ausweg die Schaffung einer neuen (Arbeiter-)Partei propagierte, ohne dabei klar und deutlich zu sagen, was für eine Politik diese neue Partei machen soll. Dabei steht das Unvermögen im Vordergrund, dem Sozialreformismus eine aktuelle, revolutionäre und zugleich nichtsektiererische Alternative entgegenzusetzen. Heraus kommt dabei ein zentristischer Eiertanz zwischen Bewegungsfetischismus, Anpassung und dem Festhalten an vereinzelten sozialistischen Glaubenssätzen.
Da ist zum anderen aber auch die Krise des übriggebliebenen sozialdemokratischen Milieus, das sich angesichts der neoliberalen Misere der Schröderschen SPD nach den guten alten Zeiten sehnt, in denen es so schien, als sei das Los der Arbeiterklasse im Kapitalismus stetig zu verbessern. Einen Kampf für ihre Reformperspektiven hat diese Strömung nicht geführt, sondern von Schröder sang- und klanglos kapituliert. Lafontaine ist deshalb ihr würdiger ideeller Repräsentant. Dieser Teil der Partei, dessen Führung mit allen Varianten bürokratische Tricks der Gewerkschaftsapparate vertraut ist, hält in der WASG organisatorisch und politisch die Zügel in der Hand.
Die führenden Köpfe dieses Milieus hatten allerdings begriffen, was der PDS-Führung entging: Daß eine zumindest lautstarke Opposition gegen neoliberale Politik unverzichtbar ist, wenn die Formierung einer neuen politischen Partei der Linken und der Einzug in die Parlamente gelingen soll. Zugleich halten diese Kräfte aber kompromißlos an ihrer prokapitalistischen Einstellung fest. Sie wollen einen kapitalistischen Sozialstaat nach Art der frühen siebziger Jahre, keinen Sozialismus.
Das heißt aber auch, daß diese Strategen der WASG (und künftig einer neuen Linkspartei) die sich abzeichnenden Ansätze eine neuen außerparlamentarischen Bewegung gegen den Neoliberallismus nur als Vehikel zur Erneuerung eines linksbürgerlichen Parlamentsprojekts ausnutzen wollen.
Die Fusion dieser beiden Gründungsströmungen in der WASG konnte nur um den Preis der Unterordnung der sozialistischen Kräfte unter die Sozialdemokraten erfolgen. Der Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ließ die optimistischen Blütenträume der WASG zerstieben. Es wurde ein Achtungserfolg erzielt, aber kein Durchbruch. Die ständigen Bremsmanöver der alten Sozialdemokraten, die die Gründung der WASG verzögerten und viele Interessenten außen vor hielten, hatten die WASG den besten Zeitpunkt für die WASG-Gründung, den Höhepunkt der SPD-Krise, verpassen lassen. Damit hatte sich die sozialdemokratische Fraktion der Gründer zwar die Kontrolle über das Projekt gesichert, aber der Gründungselan der WASG war erst einmal ermattet. Das relativ magere Wahlresultat in NRW war die Quittung. Danach erschien der angestrebte Einzug in den Bundestag jedenfalls im Alleingang unwahrscheinlich.
Schröders Flucht nach vorn zwang die WASG, sich überhastet mit der Option eines Bündnisses mit der PDS zu befassen. Vergessen waren die sozialdemokratischen Abgrenzungsrituale gegen die SED-Nachfolger. Jetzt wurde ihnen ein vollzogener demokratischer Lernprozeß attestiert. Zur vordergründigen Wahrung der vorgeblichen politischen Identität wurde ein alberner Namensstreit vom Zaun gebrochen, der Abgrenzung suggeriert, wo sich die altsozialdemokratischen Apparatschiks der WASG mit den neusozialdemokratischen Apparatschiks der PDS schon längst über ihr gemeinsames Minimal- und Maximalprogramm verständigt haben, die Besetzung von Parlamentssitzen.
Wahlsieg des Bündnisses wird die Krise der Linken nicht beenden
Ein Nebenprodukt des jetzt beginnenden Fusionsprozesses werden zunächst kleine Krisen sowohl in der PDS wie auch in der WASG sein.
Wir erleben dabei in der PDS das groteske Schauspiel, daß die übriggebliebenen Reste der Kommunistischen Plattform und Teile des ehemaligen Geraer Dialogs der PDS einer Fusion mit der WASG mit dem verschrobenen Argument Widerstand leisten, die PDS sei eine sozialistische Partei, die WASG aber nur eine Sozialstaatspartei. Von Inhalten und Perspektiven sozialistischer Politik ist dabei keine Rede. Diese Leute haben nicht nur verdrängt, daß die PDS ein kapitalistisches Programm beschlossen hat. Sie übersehen zugleich die Kleinigkeit, daß sich die PDS in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an der Zerstörung des (bürgerlichen) Sozialstaats beteiligt. Richtig ist nur die Ahnung, daß die Fusion zweier sozialdemokratischer Apparate unter dem Banner einer offen bürgerlichen Politik die Aufrechterhaltung der letzten Illusionen in den sozialistischen Charakter der fusionierten Partei erschwert. Aber diese Linken haben sich in dieser Hinsicht schon bisher als findig erwiesen.
Richtig an den Ängsten Sarah Wagenknechts ist nur, daß das neusozialdemokratische Bündnis die Parteirechte vorläufig nicht mehr zwingt, auf die letzten Linken in der Partei vordergründig Rücksicht zu nehmen, um die linkere Wählerbasis nicht zu verprellen. Sobald sich die Parteirechte sicher genug fühlt, sobald sie ihre Parlamentssitze gefestigt sieht, wird sie mit den letzten Linken aufräumen. Im Hinblick auf die parlamentarische Praxis bestimmt die Parteirechte seit eh und je die politische Agenda der PDS. Und die vom PDS-Apparat gemeinsam und einvernehmlich exklusiv mit der Parteirechten der WASG vollzogene Aufstellung der offenen Listen zur nächsten Wahl belegt, daß sich daran nichts ändern wird.
Umgekehrt schließen auch diejenigen Altsozialdemokraten der WASG vor der neoliberalen Politik in Berlin die Augen, die die Ablehnung des Neoliberalismus tatsächlich halbwegs ernstnehmen, weil der Glanz der erhofften Parlamentssitze sie bereits jetzt blendet. Die Hoffnungen der Linken in der WASG, daß mit ihr der Widerstand gegen die neoliberale Politik im Parlament wenigstens eine konsequent altsozialdemokratische Stimme erhält, gründet sich angesichts dessen nicht einmal auf einen Anschein von Realismus. Und man muß naiv sein, wollte man die Vorboten neuer Rechtsentwicklungen übersehen: Schon kündigen Gysi und Lafontaine an, daß sie sich ein späteres Zusammengehen mit einer post-schröderschen SPD gut vorstellen können.
Derweil hoffen die Altsozialdemokraten im WASG-Vorstand, daß sie die sozialistischen Strömungen in der WASG mit Hilfe des PDS-Apparats marginalisieren und gegebenenfalls aus der Partei drängen können. Besonders in Berlin darf man sich dabei auf interessante Auseinandersetzungen freuen, zuallererst um die Frage, ob die WASG bei den nächsten Wahlen gegen die PDS antreten wird oder sich dieser zugunsten einer Fusionsperspektive mit der PDS in diese ein- und damit deren Politik unterordnen wird. Der Ausgang dieser Auseinandersetzungen wird höchstwahrscheinlich auf Bundesebene entschieden werden. Die Apparate werden um so erfolgreicher sein, je besser es ihnen gelingt, die politische Bühne der nationalen parlamentarischen Politik zu besetzen und so vordergründig Erfolge vorweisen zu können.
Mit dem linken Wahlbündnis ein Aufbruch zu neuen Ufern?
Halten wir fest: Die PDS will zurück in den Bundestag und die WASG-Gründer um jeden Preis hinein, um dort als Sozialstaatspartei alte sozialdemokratische, aber natürlich nicht sozialistische Politik wiederaufleben zu lassen. Vertraut man den jüngsten Meinungsumfragen, wird die Rechnung aufgehen. Der Einzug in den Bundestag erscheint sicher. Das linke Wahlbündnis könnte dritte parlamentarische Kraft werden und möglicherweise die mit Abstand lautstärkste Partei. Ganz offenkundig sehen viele Wähler im neuen Parteienbündnis die einzige Chance, ihren Protest gegen die aktuelle neoliberale Politik der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen und hoffen, daß Gysi und Lafontaine der neoliberalen Allparteienkoalition zeigen werden, wo der Hammer hängt. Leider wird es dabei beim Zeigen bleiben.
Ungeklärt bleibt nämlich, welche Politik beide Bestandteile im Einzelnen gemeinsam vertreten wollen. Es fehlt dieser selbsternannten neuen gesamtdeutschen Linken an einer gemeinsamen Einschätzung der Lage und einer gemeinsamen Bestimmung der strategischen Achsen linker Politik. Ihr ganzes Denken kreist um die Frage, wie der Einzug ins Parlament gesichert werden kann? Was für sie zählt sind Parlamentssitze. Nichts sonst. Das gilt ebenso für ihre Bestandteile wie für beide zusammen, für ihre Führungen und leider auch den größten Teil ihrer Basis. Es wird keinen Schritt weiter gedacht, als bis zur Wahl.
Parlamentarismus und sonst nichts
Ohne sozialistische Zielsetzung benötigt die neue Linkspartei keine Strategiedebatte, solange Wahlerfolge die einzige Meßlatte für Erfolg oder Mißerfolg der eigenen Politik sind.
Das Verständnis dafür, daß die strategische Achse des Kampfs für den Sozialismus nur der praktische Klassenkampf sein kann, d.h. der außerparlamentarische Kampf, braucht und kann nicht entwickelt werden. Die WASG-Linke, befindet sich deshalb von vornherein auf verlorenem Posten. Und im Hinblick auf darauf, unter welchen Voraussetzungen parlamentarische Präsenz beim sozialistischen Kampf helfen kann, herrscht leider völlige Konfusion.
Die große Hoffnung der linken Strömungen beider Parteien, daß die parlamentarische Präsenz der Reformisten dem Klassenkampf von unten neue Schubkraft verleiht, dürfte deshalb vergeblich sein. Die Reformisten werden im Gegenteil verkünden, daß sie die Probleme der Arbeiterklasse stellvertretend für diese in den Parlamenten lösen werden und können. Damit werden sie parlamentarische Illusionen eher verstärken und die wenigen Elemente von Klassenselbstbewußtsein eher zersetzen als fördern. Es sei darauf verwiesen, daß Gysi und Lafontaine keine unbeschriebenen Blätter sind. Die Erfahrungen mit ihnen liegen vor. Sie müssen nur zur Kenntnis genommen werden.
Sozialistische Politik im Parlament muß Aufklärungsarbeit leisten, die Pläne und Vorhaben der herrschenden Klasse bloßstellen und ihre Repräsentanten schonungslos attackieren. Hierzu bedarf es politischer Klarheit, keiner pseudolinken populistischen Demagogie und noch viel weniger zweifelhafter Bündnisse. Die Propagierung reformistischer Illusionen, die Schönrednerei des Kapitalismus, indem behauptet wird, es könne im Kapitalismus alles besser werden, wenn man Gysi und Lafontaine nur machen ließe und sie darauf verzichten, mal wieder auf Tauchstation zu gehen, kann nur kontraproduktiv sein.
Für den Aufbau einer neuen revolutionären Arbeiterpartei
Für marxistische Sozialisten sind Parlamentssitze kein Selbstzweck. Das Parlament kann Tribüne des Klassenkampfs sein. Aber dazu bedarf es einer revolutionären Partei mit klarem Programm und einer fest umrissenen Strategie. Diese ist derzeit noch nicht in Sicht. Es existieren nur kleine marxistische Zirkel wie z.B. der Arbeitskreis Marxistische Theorie und Politik in Berlin oder die Marxistische Initiative in München, die Ansätze zu einer klaren sozialistischen Perspektive verfolgen. Aber davon gibt es noch viel zu wenig.
Die DKP-Führung, von der Wende in den Weltläufen immer noch nicht erholt, bietet keinen Ausweg. Sie würde sich dem reformistischen Projekt einer vereinigten neuen linken Wahlpartei gern anschließen, wenn man sie nur ließe. Frei nach dem Motto: Dabeisein ist alles. Vorwärtsweisende Impulse gibt sie nicht.
Parlamentarismus als Selbstzweck
- der Reformismus ohne Strategie
Die von Journalisten häufig gestellte Frage, welche Strategie die WASG verfolgt, wie und mit wem sie ihre (!) Ziele durchsetzen will, wenn sie eine Zusammenarbeit mit Rotgrün ablehnt, wird auch das neue Wahlbündnis nicht beantworten können. Reformforderungen, lange Kataloge toller Ziele, haben Reformisten und selbst bürgerliche Sozialreformer schon immer präsentiert, besonders vor Wahlen. Dabei wird jedem alles versprochen. Aber die Frage nach dem WIE der Durchsetzung wird nicht angerührt. Und dabei ist von Gesellschaftsänderung oder gar Revolution noch gar nicht die Rede.
Allein können die linken Reformer nicht. Aber Bündnispartner für eine soziale Reformpolitik sind in den Parlamenten nicht in Sicht. Mit den jetzt vorhandenen potentiellen Bündnispartnern kann man nur sich selbst und seine Ziele verändern, wenn man es denn unbedingt darauf anlegt, in den Parlamenten irgendetwas zu bewegen.
Weil mit der SPD keine Sozialreformen zu machen waren und sind, sind schon die Grünen gescheitert (auch als Lafontaine noch deren Parteichef war) und haben sich von einer sozialen Protestpartei in eine ökoliberale Mittelstandspartei verwandelt. Die PDS wurde in Berlin zum Fahnenträger des Neoliberalismus und bekennt sich in ihrem Programm zur kapitalistischen Marktwirtschaft. Damit wurde der Sozialismus auch noch auf dem Papier entsorgt. Gysi hat nie etwas anderes als ein Bündnis mit der SPD angestrebt. Wer heute einen Neuanfang proklamiert, der muß sich deshalb die Frage gefallen lassen, wie er der strategischen Zwickmühle nur parlamentsorientierter Reformpolitik entkommen will.
Reformistische Besserwisserei
Die Reformisten wollen daran glauben, daß alles nur davon abhängt, die Herrschenden mit Argumenten davon zu überzeugen, daß die Ziele der Reformisten im wohlverstandenen Interesse des Kapitals liegen. Sie glauben, sie können den Kapitalismus besser verwalten als die Kapitalisten und zeigen doch nur, daß sie die Triebkräfte des kapitalistischen Systems nicht verstanden haben. Die Reformisten können und wollen deshalb auch nicht verstehen, warum sich die Kapitalisten nicht mehr auf die Rezepte der Reformisten einlassen wollen. Und sie ignorieren alle Erfahrungen der Vergangenheit.
Der Sozialstaat hatte seine Grundlage in der Wachstumsphase nach dem 2. Weltkrieg. Die historischen Sonderfaktoren, die diese Blüteperiode ermöglichten, vor allem gigantische Kriegszerstörungen und Niedriglöhne, existieren nicht mehr. Angesichts enger werdender Verteilungsspielräume und einer verschärften internationalen Konkurrenz, setzt das Kapital jetzt wieder auf Aufrüstung, eine aggressive Außenpolitik und auf Klassenkampf von oben.
Die Vorstellung, man könne nach den Rezepten des Ökonomen Keynes durch die Stärkung der nationalen Nachfrage (staatliche Investitionsprogramme und Stärkung der Massenkaufkraft) den Sozialstaat der Periode des Wirtschaftswunders nach dem 2. Weltkrieg wiederbeleben, ist angesichts offener Weltmärkte (Globalisierung) nicht nur theoretisch fragwürdig.
Wer Kapitalismus sagt, muß auch Neoliberalismus sagen
Obwohl die kaufkräftige Nachfrage auf dem Weltmarkt nicht ausreicht, um die Produktionskapazitäten auf dem Weltmarkt auch nur annähernd auszulasten und obwohl deshalb reine Erweiterungsinvestitionen in der Regel nicht auf der Tagesordnung stehen, droht heute selbst großen Konzernen der Untergang, wenn sie ihre Profite nicht maximieren. Es drohen ihnen dann feindliche Übernahmen und die Zerschlagung ihrer eigenen jahrzehntelang gewachsenen halbmonopolistischen Strukturen.
Das bedeutet in der Konsequenz nicht nur die Absenkung von Lohnnebenkosten, weitere Rationalisierungen der Produktion, Verlängerungen der Arbeitszeit, sondern auch den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Zerstörung des sozialen Netzes vor allem für die Arbeitslosen. Damit kann die Arbeitslosigkeit zur Disziplinierung und Einschüchterung der Arbeitenden und als Instrument zur Durchsetzung von Lohnsenkungen ausgenutzt werden. In allen imperialistischen Volkswirtschaften muß deshalb ein neoliberaler Wettlauf stattfinden. Gewinner ist, wer die Mehrwertrate am schnellsten steigert. Nur, wer diesen Wettlauf immer wieder gewinnt, kann Exportweltmeister bleiben und auf Dauer eine Dirigentenrolle im imperialistischen Konzert spielen. Ein funktionierendes soziales Netz und die Stärkung der Massenkaufkraft sind damit unvereinbar.
Wer Politik im Interesse der abhängig Beschäftigten, der Rentner, Kinder, Jugendlichen und Arbeitslosen machen will, wird gezwungen sein, die ganze kapitalistische Maschinerie zu stoppen. Es ist nicht möglich, nur die Laufrichtung eines Rädchens dieser Maschinerie umzudrehen. Und wenn Lafontaine erklärt, er wolle dieselbe Belastung der Kapitalisten wie in anderen Ländern, zeigt er, daß er nicht versteht, worum es diesen geht. Die Kapitalisten sind nicht bereit, den mühsam gegen die eigene Arbeiterklasse erkämpften Konkurrenzvorsprung gegenüber der internationalen Konkurrenz wieder aus der Hand zu geben. Deshalb sind die Rezepte Lafontaines für die Bourgeoisie nur eine Lachnummer.
Noch törichter ist die Auffassung der Neoliberalen, Sozialdemokraten à la Schröder, Müntefering oder von PDS-Politikern wie Harald Wolf und Stefan Liebich, man könne durch neoliberale Politik ein neues Zeitalter des Reformismus vorbereiten. Die internationale Konkurrenz endet erst, wenn der Kapitalismus abgeschafft sein wird.
Wer seine kapitalistische Zukunft sichern will, kann nicht aufhören, sich der Kapitallogik zu unterwerfen. Die einzige Perspektive des Neoliberalismus ist die immer noch marktradikalere Fortsetzung neoliberaler Politik.
Die heutigen Neokeynesianer verschweigen, daß ihr Konzept von der bürgerlichen Politik in den siebziger und achtziger Jahren beerdigt wurde, weil es auch praktisch nicht mehr funktionierte.
Angesichts relativ gesättigter Märkte, d.h. einer durch zunehmende industrielle Überkapazitäten angezeigten tendentiellen Überproduktion, führte die Steigerung der Massenkaufkraft in den siebziger Jahren nicht zu einem selbsttragenden, anhaltenden Wachstum, sondern zu vermehrten Rationalisierungsinvestitionen, zu mehr Kapitalexport, wachsender Arbeitslosigkeit und - zu neoliberaler Politik. Grundlage hierfür war neben der Notwendigkeit der Entlastung des Kapitalmarkts (Zinssenkungen) und das allgemein akzeptierte ideologische Postulat, daß nur die Stärkung der Eigenkapitalbasis und eine verbesserte Profitrate die industrielle Produktion und damit die industriellen Neuinvestitionen ankurbeln könne.
Dies erwies sich als Ideologie im Marxschen Sinne, als falsches Bewußtsein. Selbst das exportweltmeisterliche deutsche Kapital exportiert nicht soviel, daß die Erweiterungsinvestitionen die Effekte der Rationalisierungsinvestitionen auf die Beschäftigung ausgleichen könnten. Es ist notwendig, sich der spätkapitalistischen Realität zu stellen: Die wachsende Arbeitslosigkeit und die Neuentstehung eines breiteren Armutssektors in der kapitalistischen Gesellschaft der imperialistischen Metropolen ist kein Betriebsunfall des kapitalistischen Systems, sondern gewolltes Resultat der neoliberalen Politik. Keine Variante bürgerlicher Politik kann die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Bekämpft werden nur die Arbeitslosen. Die Verteilung der vorhandenen Arbeit auf alle Lohnabhängigen durch drastische Arbeitszeitverkürzungen und die Verteidigung der Realeinkommen durch deren Indexierung (regelmäßige Anpassung an Kaufkraftverluste) ist nicht mit der Bourgeoisie durchsetzbar, sondern nur gegen sie. Und dieser Kampf endet entweder in einer Niederlage oder im Kampf für den Sozialismus.
Reformisten ohne Bündnispartner in den Parlamenten
Wer wie die Reformisten den Kapitalismus als Handlungsrahmen akzeptiert, die Kapitalisten und ihre Sachwalter als notwendige Partner sieht und die Logik der Kapitalverwertung als Sachzwänge anerkennt, der muß die Verständigung und den Kompromiß mit dem Klassengegner suchen. Aber wegen der absoluten Gegnerschaft der herrschenden Klasse zur Politik des Neokeynesianismus wird er diesen Kompromiß nicht finden. In einer Phase verschärfter Weltmarktkonkurrenz sind selbst kurzlebige Kompromisse mit der herrschenden Klasse nicht ohne Kampf durchzusetzen.
Ohne eine klare, klassenkämpferische Orientierung, ohne außerparlamentarische Massenmobilisierungen, ohne geduldige Aufklärungsarbeit zur Vorbereitung von Massenmobilisierungen geht es deshalb nicht. Die parlamentsfixierten selbsternannten Sprecher der Bewegung, die Gysis und Lafontaines, wollen sich diese Arbeit ersparen und an die Spitze der Bewegung stellen. Letztlich läuft das darauf hinaus, daß sie den vorhandenen Protest für ihre Zwecke ausnutzen, die nicht die Zwecke der Bewegung sind und nichts zur Entwicklung der Widerstandsbewegung beitragen.
Soziale Protestbewegungen und das linke Wahlbündnis
Andererseits wissen wir, daß in der Friedensbewegung, in den sozialen Protestbewegungen nach wie vor Hoffnungen in den Erfolg eines linken Parlamentarismus gesetzt werden. Andere werden die Linkspartei wählen, um so ihren Protest gegen den Neoliberalismus zum Ausdruck zu bringen.
Wir wissen, daß die Bewegung insgesamt nur dann ihre Illusionen in das neue Wahlbündnis überwinden wird, wenn die neue Wahlpartei sich selbst durch ihre eigene Politik entzaubert. Wenn man sie wählt, sollte man dies tun, um ihnen Gelegenheit zur Selbstdemaskierung zu geben. Die neue Linkspartei wird über kurz oder lang in die Regierung streben und "Verantwortung" übernehmen - für die herrschende Klasse, nicht für die Ausgebeuteten und Unterdrückten.
Um den Desillusionierungsprozeß zu beschleunigen, gilt es, das Wahlbündnis an seinem offiziellen Anspruch zu messen, eine konsequente Oppositionspolitik gegen den Neoliberalismus zu betreiben. Hierzu müßte es eine aktive Rolle bei der Entwicklung außerparlamentarischen Widerstands spielen - nicht zuletzt in den Gewerkschaften, aber auch auf der Straße. Es sollte bei seinen oppositionellen Worten gepackt werden.
Wie geht es weiter mit den Bewegungen?
Die gigantische Mobilisierung gegen den Irakkrieg zeigte, daß trotz der Schwäche der Linken wieder Massenmobilisierungen möglich sind. Der Anfang vom Ende der SPD-geführten Regierung war dann die erfolgreiche Mobilisierung gegen die Agenda 2010 im Herbst 2003. Mehr als 50.000 Teilnehmer in Berlin und danach Hunderttausende Demonstranten in Westdeutschland und schließlich deutlich mehr als eine Viertelmillion in Berlin im Frühjahr 2004 sowie die anschließenden Montagsdemonstrationen machten der herrschenden Klasse deutlich, daß sie bei der Durchsetzung ihrer Politik künftig mit mehr Widerstand rechnen muß. Die Zeit der Sprachlosigkeit ist vorbei.
Andererseits bleiben die zum Widerstand gegen die neoliberale Politik bereiten Kräfte in der Gewerkschaftsbewegung organisatorisch schwach. Die Kräfte, die diesen Widerstand ohne Illusionen in die Möglichkeiten einer erneuerten sozialen Reformpolitik leisten, sind noch deutlich schwächer. Aber die Entwicklung des realen Klassenkampfs wird ihnen in die Hände arbeiten und ihren Argumenten Gewicht verleihen. Auf absehbare Zeit wird die Linke aber auch nur zu punktuellen Mobilisierungen mit längeren Vorlaufzeiten fähig sein - und auch dies nur dann, wenn sie zu Aktionseinheiten zusammenfindet.
Die sozialdemokratisch geführten Gewerkschaftsapparate bleiben die wichtigste Bremse gegen die Entfaltung des Widerstands gegen den Klassenkampf von oben. Dies haben sie durch ihre weitgehende Abstinenz im Kampf gegen den Neoliberalismus (Montagsdemos) gezeigt. Künftig wird sich zeigen, ob die Reformisten der Linkspartei in der Lage sein werden, dem Klassenkampf positive Impulse zugeben. Nach allen Erfahrungen wird im wesentlichen nur die sozialistische Linke in der WASG weiter aktiv an den Bewegungen teilnehmen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß diese (westdeutsche) Linke von den staatlichen Institutionen aufgesogen wird, so wie viele ehemals linke Grüne in den achtziger Jahren.
Das durch die Abkehr sozialdemokratischer Wähler von der SPD bewirkte Ende der Regierung Schröder und die Entstehung einer neuen linken Wahlpartei mögen für sich betrachtet unzureichende Ergebnisse des Widerstands gegen die von der herrschenden Klasse in Deutschland geforderte neoliberale Politik sein, aber sie zeigen, daß sich unter der Oberfläche scheinbar stabiler Verhältnisse die Vorbedingungen weiterer Widerstandsaktionen entwickeln. Die Unzufriedenheit und Bereitschaft zum Widerstand nimmt zu.
Die Lage der breiten Masse der abhängig Beschäftigten, der Schüler, Studenten und Rentner wird sich angesichts des unersättlichen Appetits der Kapitalverbände auf weitere Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben schnell deutlich verschlechtern. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer werden alle spüren. Es ist denkbar und wahrscheinlich, daß die CDU in ihrer Siegeseuphorie glaubt, Schröder im Hinblick auf Tempo und Schärfe der Konterreformen noch überbieten zu können.
Denkbar ist aber auch, daß eine große Koalition gebildet wird und daß SPD und CDU gemeinsam ausloten, wie weit sie noch gehen können. Der SPD ist durchaus zuzutrauen, daß sie ihre Politik der Selbstzerstörung weitertreibt. Ihre Hundetreue gegenüber dem Kapital kennt offenkundig keine Grenzen.
Aber das kann für das Kapital auch schiefgehen und zur Verschärfung der Klassenkämpfe auf allen Ebenen führen, weil auch die Gewerkschaftsapparate dadurch in Zugzwang gebracht werden könnten. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß sogar Teile der SPD an Mobilisierungen und Widerstandsaktionen teilnehmen werden, um verlorenes Terrain zurückzuerobern. Auf alle Fälle werden die Verhältnisse weniger stabil sein als bisher und der revolutionären Linken neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.
Die herrschende Klasse wird jedoch nicht nur Umverteilungspolitik von untern nach oben betreiben. Sie wird schon diese Umverteilungspolitik ungleichmäßig betreiben und eine Politik der rassistischen und chauvinistischen Klassenspaltung forcieren. Nicht zuletzt auch, um ihrer zunehmend aggressiven Außenpolitik den Deckmantel zivilisatorischer Missionen umhängen zu können. Sozialistische Politik muß deshalb zugleich internationalistisch, antiimperialistisch und antimilitaristisch sein.
Unsere Alternative:
Abschied vom Mythos Sozialstaat nehmen.
Widerstand leisten.
Mit dem Kampf für den Sozialismus jetzt beginnen!
Der Ausweg liegt darin, eine aktive Politik zur Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu betreiben. Das ist nur möglich, durch die systematische Verbreiterung und Vertiefung außerparlamentarischer Bewegungen gegen alle Aspekte bürgerlicher Politik und durch die Entfaltung gewerkschaftlichen Widerstands. Hierzu bedarf es mehr als nur Protest und Widerstand.
Notwendig ist ein Übergangsprogramm, das ohne Rücksicht auf die Logik der Kapitalverwertung die Interessen aller abhängig Beschäftigten, der Arbeitslosen, der Jugend und der von dieser Gesellschaft Ausgegrenzten vertritt und so dem Klassenkampf von oben den von untern entgegensetzt.
Hierzu haben Reformisten noch nie wesentliche Beiträge geleistet. Wenn sie sich unter dem Druck ihrer Basis an Mobilisierungen beteiligten, dann nur kurzfristig und um sich an die Spitze von Bewegungen zu stellen und sie danach schnell wieder abzuwürgen. Trotzdem werden und müssen sich revolutionäre Linke immer dafür einsetzen, daß Reformisten im Interesse einer breiten Bewegung an Kämpfen teilnehmen. Gleichzeitig gilt aber auch, daß beides, die Entwicklung von Bewegungen und gewerkschaftlichem Widerstand letztlich nur möglich ist, durch eine systematische Zurückdrängung des politischen Einflusses der Sozialdemokratie und anderer Varianten von Reformideologie.
Die revolutionäre, marxistische Linke ist derzeit noch schwach und zu zersplittert, um eine für die breite Masse der Arbeiterklasse als faßbare politische Alternative zu erscheinen. Dennoch heißt es, mit dieser Arbeit zu beginnen. Die Reformisten werden diese Arbeit nicht leisten. Und wer heute nicht mit der Arbeit beginnt wird auch noch morgen oder übermorgen vor der gleichen großen Aufgabe stehen. Es gibt hierzu keine leichtere oder schneller funktionierende Alternative. Wer sich der Aufgabe stellen will, kann mit uns den Kampf beginnen. Jede Art von Unterstützung ist willkommen.
Arbeitskreis Marxistische Theorie und Politik (Berlin/Brandenburg)
Marxistische Initiative (München)